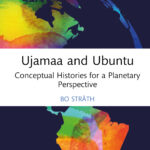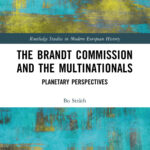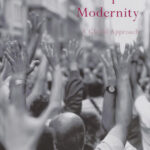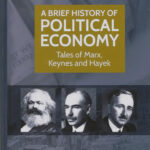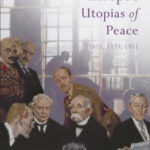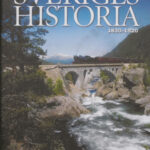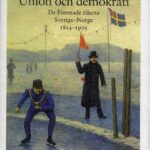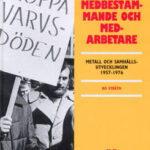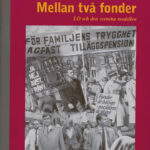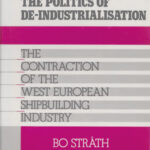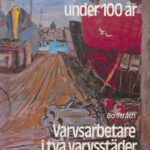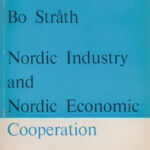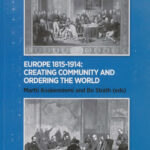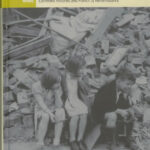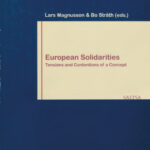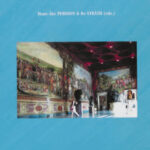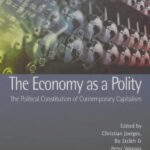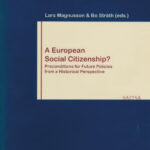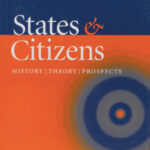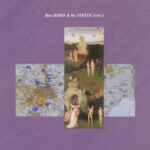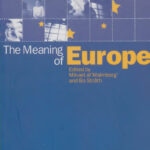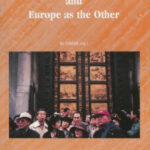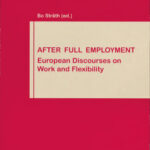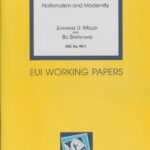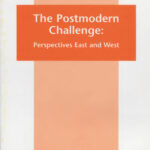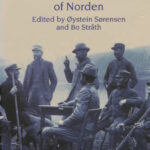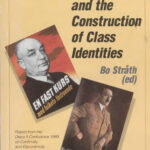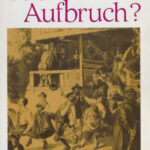Der Ausgangspunkt: eine kurze westliche Saga, die in den 1960er Jahren ihren Höhepunkt fand
Es wäre falsch, die Entwicklungen in den USA seit 2016 als ein ausschließlich amerikanisches Problem zu diskutieren. Die Ereignisse in den USA seit 2016, die sich seit 2025 beschleunigt haben, finden vor dem Hintergrund eines allgemeineren globalen Zeitgeistes statt, der von einer Erosion der Demokratie, einem neuen alten Imperialismus rund um Ideen der Geopolitik und Geoökonomie sowie einem Wertnihilismus geprägt ist, bei dem Überzeugungen über stabile Werte durch starke Emotionen in digitalen sozialen Netzwerken aufgelöst werden. Demokratien mutieren zu autoritären und paternalistischen Regierungsformen. Das Etikett „illiberal” stellt liberale Vorstellungen von Demokratie in Frage. Diese Trends sind miteinander verknüpft und verstärken sich gegenseitig. Es ist dieser allgemeine Abwärtstrend, aus dem sich der amerikanische Erdrutsch im November 2024/Januar 2025 ergab, vor dem Jürgen Habermas (2025; vgl. Stråth 2025) warnt, dass er auch in Europa eintreten könnte, wenn dessen Führungskräfte nicht aktiv Gegenmaßnahmen ergreifen.
Die Demokratie im modernen Sinne, das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen und ein parlamentarisches System mit erheblichem Einfluss auf den Inhalt der Politik, setzte sich in den 1920er Jahren nach der Massenmobilisierung für den Ersten Weltkrieg durch. Die Demokratie als Ideal und der Kampf für Demokratie sind älter. Der Durchbruch betraf nur einen begrenzten Teil der Welt, nämlich die Industrieländer. Die Massenmobilisierung für den Zweiten Weltkrieg vertiefte die politische Substanz der parlamentarischen Arbeit mit Ideen einer universellen, staatlich organisierten Wohlfahrt, jedoch in einer Welt, die auf den sogenannten Westen beschränkt war: die Vereinigten Staaten, Westeuropa und Japan (nach 1945). Die Ausweitung der Wohlfahrtsstaaten in Westeuropa in den 1960er Jahren kann als demokratisches Goldenes Zeitalter angesehen werden. Das Zentrum der Politik waren die Parlamente. Es ist die Zeit, die der irische Politikwissenschaftler Peter Mair (2013) in einem posthum veröffentlichten Buch als Höhepunkt der Demokratie ansieht, als auch der Niedergang begann. Bis dahin war die Politik interessenbasiert und ideologisch von den widersprüchlichen Interessen geprägt, die sich in der Industriegesellschaft entwickelt hatten. Diese Interessen und ihre Ideologien entwickelten soziale Identitäten, die in den nationalen Parlamenten aufeinanderprallten. Die Kompromissarbeit führte zu nationalen Identitäten, die Interessenkonflikte sowohl überbrückten als auch perpetuierten.
Wenn der Erste Weltkrieg zum Durchbruch der Demokratie führte, so brachte der Zweite Weltkrieg ihre Perfektionierung in einem kleinen Teil der Welt als westliche gemischte Wohlfahrtsstaaten mit Massenkonsum und Massenproduktion in einer sich gegenseitig verstärkenden Dynamik. Keynes’ Wirtschaftstheorie legitimierte das System. Die Theorie betonte die politische Stimulierung der ökonomischen Nachfrage. Das Wachstum sorgte für einen immer größer werdenden Kuchen, der eine Verteilungspolitik mit Hilfe der progressiven Besteuerung als Instrument ermöglichte. Der Wohlstand war auch ein ideologisches Instrument im Kalten Krieg, ein Vorzeigeprojekt gegen den Staatssozialismus in Osteuropa. Es herrschte die feste Überzeugung, dass das, was als Social Engineering angesehen wurde, eine dauerhafte Ordnung gefunden hatte. Aber niemand glaubte, dass die Geschichte zu Ende sei. Der Kalte Krieg drohte, alles zu zerstören.
Die Interessen überwindende und kompromisssuchende Demokratie, die bei Mair in den 1960er Jahren ihren Höhepunkt erreichte, basierte auf einer sozialen Disziplin, die unter dem Druck des Weltkriegs entstanden war, einer sozialen Disziplin für den nationalen Zusammenhalt. Sie setzte sich während des nuklearen Terrors des Kalten Krieges fort. Der Druck ließ nach den aufeinanderfolgenden Krisen im Kongo, in Berlin und in Kuba in den Jahren 1960-1962 nach. Nach Kuba schien der Abgrund nicht mehr so unmittelbar nahe. Die soziale Disziplin wurde lockerer, mit „1968“ als sichtbarem Zeichen. Auch die Konflikte um die Verteilung nahmen zu (Stråth und Trüper 2025). „1968“ war eine Revolte einer Generation mit Protesten gegen Massenkonsum, Überfluss und Umweltzerstörung. Die Protestierenden forderten globale Gerechtigkeit und mehr Unterstützung für Entwicklungsländer. Die Proteste breiteten sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der gesamten westlichen Welt aus. In Deutschland ging es darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie die ältere Generation den Nationalsozialismus zugelassen und unterstützt hatte; in Frankreich waren die Mandarine an den Universitäten und der autoritäre Stil de Gaulles das Ziel; in den USA war es der Vietnamkrieg. Die westlichen Proteste inspirierten den Prager Frühling in der Tschechoslowakei, der die Sowjetunion dazu veranlasste, mit militärischer Gewalt zu intervenieren. Die Arbeiterbewegung im Westen radikalisierte die Frage der Verteilung und stellte den Konsens in Frage, der bisher vorherrschte: zu verhindern, dass Interessenkonflikte außer Kontrolle geraten. Es wurden Stimmen laut, die sich für Mitbestimmung und Unternehmensdemokratie mit einer neuen Sichtweise auf Eigentumsverhältnisse aussprachen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Druck auf die Demokratie von innen zunahm, während er von außen während des Kalten Krieges nachließ.
Einige Jahre vor „1968” begann der Übergang, den Peter Mair als eine Verlagerung vom ideologie- und interessenorientierten Kompromiss in der Frage der Verteilung hin zu einer Professionalisierung und Technokratisierung der Politik identifizierte, was auch eine Entideologisierung bedeutete. Neue Theorien in den Sozialwissenschaften über den Wohlfahrtsstaat und die soziale Gemeinschaft legitimierten diese Entwicklung. Die politischen Parteien begannen, außerhalb ihrer Interessengruppen nach einer Maximierung ihrer Stimmen zu streben, wodurch sowohl die Definition von Interessen als auch ihre ideologische Triebkraft verwässert wurden. Die Grundlage für parlamentarische Kompromisse wurde schwieriger zu verstehen. Politik wurde zu technokratischer Verwaltung und Kartellbildung, wodurch echte Opposition verschwand, da sich die bedeutenden Unterschiede zwischen den Parteien auflösten. Die Radikalisierung der 1960er Jahre kann als Protest gegen Entideologisierung und Technokratisierung in einer Zeit gesehen werden, in der die äußeren Umstände, der Kalte Krieg, ideologischen Kampf ermöglichten.
Als die Vereinigten Staaten an einem Sonntag im August 1971 bekannt gaben, dass sie ihre Bretton-Woods-Verpflichtung, den Dollar an einen festen Goldpreis zu binden, nicht mehr einhalten könnten, änderten sich die Bedingungen für Proteste grundlegend. Der Fall des Dollars führte zu einer rapide steigenden Inflation, was die Ölproduzenten der Welt, die meisten davon im armen Süden, dazu veranlasste, ihre Preise drastisch zu erhöhen. Die Öllieferungen gingen zurück und ihre Zukunft wurde ungewiss. Der Bau von Supertankern brach zusammen. Die Schiffbauindustrie sowie ihre zahlreichen Zulieferer in der Stahlindustrie und anderen Branchen gerieten in eine strukturelle Krise mit Massenarbeitslosigkeit. Es war eine Krise des sogenannten fordistischen Produktionssystems mit Fließbändern und Akkordarbeit. Der Ölpreisanstieg schockierte und überraschte die politischen Führer des Westens, die sich in einer systemischen Krise wiederfanden. Die radikale Welle der späten 1960er Jahre kam zu einem Ende.
Die Dritte Welt knüpfte dort an, wo „1968” und die Radikalisierung der Arbeiterklasse aufgehört hatten. Ihre Führer sahen Öl als Beispiel für andere Rohstoffe. Vereint als G77 forderten sie eine neue internationale Wirtschaftsordnung (NIEO) mit höheren Rohstoffpreisen und Möglichkeiten zur Verstaatlichung westlicher Unternehmen in Entwicklungsländern (im Austausch gegen Entschädigungen). Für einige Jahre (1973–75) machten sie die UNO zum Hauptschauplatz für die Verhandlungen ihrer Forderungen mit den Industrieländern. Zum Ost-West-Konflikt des Kalten Krieges kam ein Nord-Süd-Konflikt hinzu. Die alarmierten westlichen Führer gründeten die G7, um die Bedrohung durch die G77 abzuwehren (Stråth 2023: 109–115).
Diese Situation veranlasste Arbeitgeber und Kapitaleigner, die ihnen durch den Kalten Krieg auferlegte Selbstdisziplin endgültig aufzugeben. Mit dieser Absicht folgten sie den radikalen Arbeitern, die mehr Einfluss auf die Unternehmen gefordert hatten, natürlich mit anderen Zielen. Die NIEO mit ihren Forderungen nach Möglichkeiten zur Verstaatlichung von Unternehmen war neben der Radikalisierung der Arbeiter in Westeuropa ein weiterer Anreiz, die Politik der dreigliedrigen Verhandlungen (Regierungen, Arbeitgeber, Gewerkschaften) zur Lösung des Interessenkonflikts aufzugeben.
Die Krise des fordistischen Produktionsregimes führte zu neuen Denkweisen über Produktivität und Profit. Die Zukunft lag in der Produktion von Finanzdienstleistungen. Es wurden starke Forderungen nach ihrer Internationalisierung außerhalb der Kontrolle nationaler Regierungen laut. Der neoliberale Bruch begann. Im Westen führten Margaret Thatcher und Ronald Reagan, unterstützt durch die Wirtschaftstheorien von Friedrich Hayek und Milton Friedman, den Bruch mit der 1944 in Bretton Woods etablierten westlichen Nachkriegsordnung, die die Grundlage für mehrere Jahrzehnte funktionierender Wohlfahrtsdemokratie gebildet hatte, die so gut funktioniert hatte, dass viele glaubten, sie sei auch für die Zukunft garantiert.
In den USA sah Samuel Huntington ebenfalls einen Wendepunkt in den 1960er Jahren, allerdings einen anderen, als er Mitte der 1970er Jahre über den Zusammenbruch des Dollars in den Jahren 1971-73 und die darauf folgende globale Krise nachdachte (Crozier, Huntington und Watanuki 1975). Die Massen forderten zu viel, argumentierte er. Die Demokratie treibe Forderungen voran, die die finanziellen Möglichkeiten des Staates überstiegen. Huntington schlug vor, ein Gleichgewicht zwischen demokratischer Vitalität und staatlicher Leistungsfähigkeit herzustellen, indem die demokratischen Möglichkeiten eingeschränkt würden. Man könnte auch sagen, dass er die soziale Disziplin wiederherstellen wollte. Huntington lieferte Argumente für die aufkommende neoliberale Erzählung, in der Sparmaßnahmen zu einem Instrument zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts und Steuersenkungen als Konjunkturimpuls wurden, anstatt staatliche Ausgaben, wie es das keynesianische Handbuch empfahl. Laut Huntington sollte Demokratie so gestaltet sein, dass sie sich mehr auf ihre Form als auf ihren Inhalt konzentriert. Dieses Argument ließ sich leicht mit der neoliberalen Ausrichtung von Politik und Wirtschaft in den 1970er Jahren in Einklang bringen. Das Problem aus demokratischer Sicht war, wer zur Selbstdisziplin verpflichtet und wer davon befreit werden sollte. Huntington hat dies jedoch nicht so formuliert.
Der neoliberale Durchbruch
Der neoliberale Durchbruch in den 1980er Jahren, der sich in den 1990er Jahren zu einer fast schon als Hegemonie zu bezeichnenden Position verstärkte, war eng mit dem Übergang von der industriellen Güterproduktion zu Finanzdienstleistungen als Wachstumsmotor verbunden, insbesondere durch die Deregulierung und Internationalisierung der Kapital- und Kreditmärkte sowie des Devisenhandels. Investieren in Geld wurde zum Motto, das zu wachsenden Einkommens- und Vermögensunterschieden führte und sich von dem entfernte, was die keynesianischen Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegszeit geprägt hatte. Der spekulative Devisenhandel übte Druck auf die Regierungen der Nationalstaaten aus, die ihre nachfragefördernde keynesianische Politik mit einer strengen Kontrolle der Kreditmärkte und des Devisenhandels kombiniert hatten. Als diese neue Freiheit später mit digitaler Technologie kombiniert wurde, um Trends zu erkennen und spekulative Kauf- oder Verkaufsentscheidungen mit Transaktionen im Nanosekundenbereich zu treffen, nahm der Druck auf die Regierungen noch weiter zu.
Der schwedische Ministerpräsident Ingvar Carlsson und Finanzminister Kjell-Olof Feldt sind gute Beispiele für eine allgemeinere Situation, die insbesondere die sozialdemokratischen Parteien Europas betraf und bereits in der vordigitalen Ära zu Spannungen zwischen Regierungschefs und Finanzministern führte. Rolf Gustavsson hat beschrieben, wie sich nach dem Wahlsieg 1988 der Ton der Gespräche zwischen ihnen in Bezug auf ihre Ansichten zur Wirtschaft und die Möglichkeiten einer nachfrageorientierten Politik verschärfte. Der Ministerpräsident hatte einen Wutausbruch:
Was ist in diesem Land los? Die Regierung hat sich durch einen Haushaltsprozess gekämpft, in dem wir hart daran gearbeitet haben, die Ausgabensteigerungen auf null zu senken, um die schwedische Wirtschaft im Gleichgewicht zu halten. Gleichzeitig pumpen die Banken Geld in ihre Kunden, um den Konsum anzukurbeln. Man kann keine Zeitung aufschlagen, ohne riesige Anzeigen für zinsgünstige Kredite zu sehen. Verdammt, dass die Wirtschaft überhitzt ist (Gustavsson 2010:51).
Im Nachhinein hat Carlsson die Deregulierung des Kreditmarktes als seinen größten Fehler während seiner siebenjährigen Amtszeit als Ministerpräsident bezeichnet. Im Nachhinein hat Feldt zugegeben, dass er die Folgen der Deregulierung unterschätzt habe, aber gleichzeitig behauptet, dass es keine andere Wahl gegeben habe (Gustavsson 2010: 50-55).
Die Befreiung der Kapitaleigner von nationalen Barrieren zwang die Regierungen zu Zurückhaltung bei den öffentlichen Ausgaben. Hohe Defizite führten zu steigenden Zinsen für die zur Finanzierung der Defizite aufgenommenen Kredite, was wiederum den Spielraum für neue Zukunftsvisionen und kreative Politik einschränkte. Die Politik konzentrierte sich zunehmend auf die administrative Verwaltung der Ressourcen innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen.
Interessant an den Ansichten der beiden Sozialdemokraten ist die Position des Finanzministers, dass er keine Wahl hatte, und die Meinung des Ministerpräsidenten, dass er seine Entscheidung bereute, was bedeutet, dass er der Ansicht war, dass er doch eine Wahl hatte. Man muss Carlsson zustimmen, dass es natürlich eine Wahl gab. Die Frage ist jedoch, zu welchem Preis es für ein kleines Land sein würde, sich einem internationalen Trend zu widersetzen, der als der einzig richtige Weg galt. Eine Finanzpolitik gegen die internationalen Kapitalmärkte war keine leichte Aufgabe. Die sich abzeichnende Vorherrschaft des neoliberalen Interpretationsrahmens machte es schwierig, dem Druck zur Deregulierung und Internationalisierung zu widerstehen. In Frankreich unternahm François Mitterrand 1981–83 den Versuch, die keynesianische Politik fortzusetzen, doch die Reaktion der Finanzmärkte zwang ihn, diesen Versuch aufzugeben. Nach der Deregulierung blieben die Regierungen anfällig für die Meinungen der Marktakteure, was ihren Handlungsspielraum einschränkte. Was auch immer sie taten, die Finanzakteure („der Markt“) zwangen sie in eine Zwangsjacke.
Mehr als jeder andere wird Margaret Thatcher mit TINA in Verbindung gebracht, There Is No Alternative, es gibt keine Alternative (zum Markt). Nach 1990 wurde dieser Satz zunehmend zu einem Leitmotiv. Seine Verwendung war nicht mit einer tieferen Reflexion darüber verbunden, wer der Markt eigentlich war. Der Markt wurde zu einem Fetisch, zu einer Abstraktion, die sich in der politischen Handlungsunfähigkeit konkretisierte. Die Kräfte hinter der Mystifizierung des Marktes zögerten nicht zuzuschlagen, wenn sie der Meinung waren, dass Regierungen falsch handelten. Dabei agierten sie wie ein Fischschwarm. Die Veränderung der Kontrolle über Wechselkurse und Zinssätze hatte erhebliche politische Auswirkungen. Margaret Thatcher verstärkte den Eindruck einer zunehmend hilflosen Demokratie mit dem Argument, dass es keine Alternative zu den Forderungen des Marktes gebe. Der Trend zur Professionalisierung und Technokratisierung der Politik in westlichen Demokratien, den Peter Mair in den 1960er Jahren beobachtete, beschleunigte sich, nicht weil es in der Politik um die maximierende Verwaltung von Sozialleistungen ging, sondern weil es keine Alternativen zu den Diktaten des „Marktes” gab. Politische Konflikte und der Wettbewerb zwischen Alternativen mit unterschiedlichen Zukunftsvisionen verschwanden, als sich alle in einer Art Parteikartell auf einem politischen Mittelfeld versammelten. Ursprünglich ging es bei diesem Zusammenschluss um die Maximierung der Stimmen, was nach 1990 unter dem Neoliberalismus mit einer Anpassung an den Markt einherging. Der Begriff „Post-Politik“ wurde geprägt, um diese Entwicklung zu beschreiben. Als die Proteste gegen diese Regelung zunahmen und die etablierten Parteien nicht in der Lage waren, auf die Unzufriedenheit einzugehen, da es keine Alternativen zum etablierten technokratischen „Durchwursteln“ gab, traten politische Unternehmer auf den Plan, die in der Lage waren, auf die Frustration einzugehen (Pepijn 2019). Dies waren die autokratischen Paternalisten, die Stephen Hanson und Jeffrey Kopstein (2024) im ersten Artikel in Eine Weltordnung in Auflösung (Stråth 2025) beschrieben haben, mit Donald Trump als krönendem Höhepunkt.
Colin Crouch (2009) hat beschrieben, wie die keynesianische, nachfrageorientierte Haushaltspolitik der Regierungen zunehmend privaten Banken Platz machte, die die Nachfrage durch Kredite stimulierten, was mit der Privatisierung einer Reihe staatlicher und kommunaler Dienstleistungen in Bereichen wie Bildung und Gesundheitswesen einherging. Crouch hat die Erfahrungen von Ingvar Carlsson und vielen anderen politischen Führern theoretisch aufgearbeitet. Crouch spricht von privatisiertem Keynesianismus. Die zunehmende Passivität der Staaten führte zu einer Privatisierung der Nachfragestimulierung von staatlichen Haushalten hin zu neuen Formen der Kreditvergabe, insbesondere Kreditkarten.
In einem verwässerten und entideologisierten oder, wenn man so will, hegemonial hoch ideologisierten politischen Zentrum herrschte allgemeiner Konsens darüber, dass die Parlamente den Anforderungen des Marktes unterworfen waren. Die neoliberale Globalisierungserzählung, die nach 1990 bis zum Zusammenbruch 2008 hegemonial war, legitimierte die Ordnung ohne große Debatte. Wie bereits erwähnt, gab es keine Alternative. Unter der diskursiven Oberfläche erfuhren die Arbeitsmärkte grundlegende Veränderungen, nicht zuletzt in Bezug auf die Interessenvertretung, insbesondere die Gewerkschaftsvertretung, wobei große Gruppen volatiler Niedriglohnarbeiter aus dem Sozialsystem herausfielen. Auch die Finanzmärkte erfuhren durch ihre fast vollständige Internationalisierung grundlegende Veränderungen, die sich auf die Haushaltsbeschränkungen der nationalen Regierungen auswirkten. Die Kehrseite der Globalisierungserzählung, die eingeschränkte Handlungsfreiheit der nationalen Regierungen und die Entstehung eines transnationalen Prekariats, verschwand unter der Hegemonie der Erzählung.
Demokratie mit geringer Intensität
Susan Marks (2000) war eine frühe Mitwirkende an einer breiteren Literatur, die zeigte, wie die neoliberale Demokratie zu einer Demokratie mit geringer Intensität wurde: formal, mit allgemeinem Wahlrecht, aber ohne großen Einfluss auf die Substanz der Politik. Es war diese Form, die sich mit dem Narrativ der Globalisierung weltweit verbreitete, wobei die Demokratie unter dem Markt die immer häufiger anzutreffende Regierungsform war. Die neoliberale Wirtschaft ging Hand in Hand mit der neoliberalen Demokratie, einer neuen Form der Demokratie im Vergleich zu der, die die Wohlfahrtsstaaten aufgebaut hatte. Die lebhafte Sozialkritik der 1960er Jahre verschwand und die Art der öffentlichen Debatte veränderte sich. Die Norm und Nomenklatur zur Definition von Demokratie basierte nun auf formalen Kriterien wie Wahlrecht, freien und geheimen allgemeinen Wahlen, Meinungsfreiheit usw., aber es wurde nichts darüber gesagt, wie die Wähler die politische Substanz von Themen wie soziale Gerechtigkeit und Wohlfahrt beeinflussen konnten. Die zunehmenden sozialen Spaltungen im Zuge der Globalisierung wurden außer Acht gelassen. Marks zeigt, wie freie und faire Wahlen die tieferen Machtkonzentrationen und sozialen Ungerechtigkeiten unberührt ließen. Sie argumentiert weiter, dass die Ideologie der Low-Intensity-Demokratie das Konzept der Low-Intensity-Demokratie essentialisiert, indem sie es gegen Undemokratie polarisiert und nicht gegen die vorherige, eher substanzorientierte Form. Sie spricht von teleologischem Eskapismus, wenn sie argumentiert, dass politische Rechte, die diesen Namen verdienen und nicht nur die Form, vor wirtschaftlichen und sozialen Rechten kommen müssen und dass es bei politischen Rechten darum geht, die Zukunft gestalten und das, was als falsch empfunden wird, ändern zu können. Mit politischen Rechten meint sie die Fähigkeit, den Inhalt der Politik zu beeinflussen, und nicht nur mit Akklamation zuzustimmen.
Andrew Lang (2011), der wie Marks aus der Perspektive des Völkerrechts schreibt, unterstützt das Argument, dass die Entwicklung einer formalen Demokratie geringer Intensität der politische Kern des neoliberalen Durchbruchs, der Entpolitisierung der Politik, sei. In den 1990er Jahren kam es nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums zu einer starken Ausweitung der Demokratie in der Welt. Diese Ausweitung betraf weit mehr als nur Osteuropa. Fast überall in Lateinamerika, Afrika, Asien und dem Nahen Osten entstanden Zivilgesellschaften mit demokratischen Bewegungen und dem Sturz autokratischer Herrscher. Die Medien jubelten über den Sturz autoritärer Regime und den Durchbruch der Demokratie, der mit dem Triumph der neoliberalen Globalisierungserzählung einherging.
In den kritischen akademischen Kommentaren, die nach 2000 erschienen, drückte der Begriff „Low-Intensity” dasselbe aus wie der Begriff „alternativlos”. „Low-Intensity” war das kritische Konzept aus der akademischen Betrachtung von außerhalb des politischen Prozesses, während „alternativlos” das disziplinierende Konzept von innen durch politische Führer war. Beide Begriffe bedeuteten, dass es bei der Demokratie in ihrer neoliberalen Form mehr um die Form als um den Inhalt ging und dass sie im Grunde genommen Ausdruck einer Entpolitisierung war. Die Demokratie, die im Westen unter dem Begriff „alternativlos” verwässert wurde, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg nur wenige Jahrzehnte lang Bestand, basierte jedoch auf einem anderthalb Jahrhunderte währenden Kampf seit den 1830er Jahren als Gegenbewegung zu den Schattenseiten der Industrialisierung und der Mobilisierung der Bevölkerung für zwei Weltkriege. Die Vorstellung der 1990er Jahre, dass sich die Demokratie, wie sie nach 1945 im Westen etabliert wurde, weltweit ausbreiten würde, während sie im Westen ihrer Bedeutung beraubt würde, war natürlich eine Illusion, die unter dem mächtigen Narrativ der Globalisierung erfolgreich verborgen wurde. Niemand wollte sehen, dass es einen Unterschied zwischen Demokratie und Demokratie gab.
Samuel Moyn (2010, 2018) hat gezeigt, wie die Menschenrechte der Demokratie in der Aushöhlung ihrer Substanz und der Konzentration auf die Form folgten. Ein wichtiges Menschenrecht wurde der Schutz des Eigentums, während soziale Rechte substanzlos waren. Multinationale Unternehmen wurden zu Subjekten, die unter die Menschenrechte fielen. Hinter dieser Position spürt man die Forderungen der Entwicklungsländer nach Möglichkeiten zur Verstaatlichung von Unternehmen. Moyn spricht von Menschenrechten im neoliberalen Strudel (Moyn 2018: 173; vgl. Stråth 2023: 161). Im Völkerrecht gab es eine Verlagerung von Staaten zu Individuen als Rechtssubjekten, wobei Unternehmen als juristische Personen ebenfalls mit Individuen als natürlichen Personen gleichgesetzt wurden.
Die Demokratie mit geringer Intensität vermied es, den Interessenkonflikt auf dem Arbeitsmarkt anzusprechen, und Fragen der Unternehmensdemokratie und Umverteilung verschwanden aus der Debatte. Große Teile der zunehmend segmentierten Arbeitsmärkte wurden von der Interessenvertretung ausgeschlossen. Der Klassenkonflikt verschwand aus der Demokratietheorie. Ideen über eine klassenlose Konsensgesellschaft gingen mit zunehmenden Anzeichen sozialer Marginalisierung und gesellschaftlicher Desintegration einher. Dani Rodrik (2000) spricht vom Trilemma der Globalisierung, in dem der Nationalstaat, die Demokratie und der grenzenlose Markt ein Dreieck bilden, aber nur zwei davon nebeneinander existieren können. Rodrik beschreibt eher theoretische als empirische Zusammenhänge: Demokratie und Nationalstaat können mit einem grenzenlosen Markt nicht funktionieren. Demokratie und ein grenzenloser Markt können mit Nationalstaaten als Ort der Demokratie nicht funktionieren. Nationalstaaten können nicht demokratisch sein, wenn der Markt grenzenlos ist.
Autokratischer Paternalismus
Der neoliberale Zusammenbruch einer amerikanischen Spekulationsblase im Jahr 2008, angeheizt durch den grenzenlosen und naiven Glauben der Welt an den Dollar, führte zu einem Schock, nachdem die Regierungen massive Finanzpakete geschnürt hatten, um die spekulativen Banken zu retten, die zu groß waren, um zu scheitern. Die Politik blieb ohne Alternativen im Sinne Thatchers, da sie vom Markt diktiert wurde. Es bildeten sich Meinungen, die sich auf die Verlierer der Globalisierung konzentrierten. Bei der Hegemonie ging es um die Gewinner als Weg zum Erfolg für alle. Der griechische Ökonom Yanis Varoufakis (2011: 135), der auch eine Zeit lang Finanzminister war, hat den Unterschied zwischen den Gewinnern und den Verlierern formuliert: „Die Reichen … hatten einen genialen Weg entdeckt, um noch reicher zu werden – indem sie mit Papierwerten handelten, die die Träume, Hoffnungen und letztendlich die Verzweiflung der Ärmsten der Gesellschaft verpackten.“ Die Verlierer artikulierten die Wut und Verachtung der Bevölkerung gegenüber den etablierten Parteien und ihren Vertretern. Als es politischen Entrepreneuren gelang, diese Unzufriedenheit zu kanalisieren, konzentrierten sie sich auf die Nation als Verliererin der Globalisierung, die neu geschaffen werden musste. Es entstand eine populistisch-nationalistische Protestbewegung, die sich gegen das politische Establishment richtete, das die Globalisierung gemanagt hatte, gegen die „Kosmopoliten“ und „Globalisten“. Unter Verwendung von Begriffen wie „illiberale Demokratie“ nahmen Führer mit autoritären Idealen den Kampf gegen die neoliberale Demokratie auf. Paternalismus verbreitete sich als Regierungsstil, wie Hanson & Kopstein (2024) und andere in einer umfangreichen Forschungsliteratur festgestellt haben (siehe z. B. Levitsky & Ziblatt 2018 und Lewis 2018). Es folgten radikalere Argumente über einen „Deep State“, in dem Experten Initiativen unterdrückten, und andere Verschwörungstheorien, wie Hansson & Kopstein (2024) in einem Kapitel mit dem Titel „The Deep State Bogeyman“ dokumentieren. Diese Entwicklung bildet den Hintergrund für Trumps USA, wie sie im ersten Teil von Eine Weltordnung in Auflösung (Stråth 2025) beschrieben werden.
Die Reaktionen auf den Finanzkollaps und die massive Rettung mit Steuergeldern zogen die Politik nach rechts in Form von Populismus und autoritärem Paternalismus, der die parlamentarische Verwaltung einer Politik in Frage stellte, für die es angeblich keine Alternative gab. Seit 1990 hatten sich alle um das Prinzip eines imaginären Mittelfelds geschart, der durch den Markt und dessen angebliche Anforderungen definiert war. Bis zum Triumph der Politik ohne Alternativen verlief die parlamentarische Konfliktlinie zwischen der Rechten und der Linken, die beide durch Ideologie und Interessen definiert waren. Der Konflikt und der Kompromiss zwischen ihnen hielten das Mittelfeld zusammen. Der Punkt ist, dass die Kompromisse auf ideologischen und interessenbezogenen Spaltungen beruhten, die das Mittelfeld stärkten, nun aber durch einen angeblich alternativfreien Markt erstickt wurden. Der Verhandlungsspielraum, der die Demokratie stärkte, verschwand. Nach 2008 tauchte die Konfliktlinie wieder auf, aber nun nicht mehr in der Mitte, sondern rechts vom Mittelfeld – eine Linie, bei der es lange Zeit darum ging, ob sie eine Grenze, eine Firewall oder eine Verhandlungslinie sein sollte. Die Verschiebung geht in Richtung einer Verhandlungslinie zwischen der gemäßigten Rechten und der populistischen Rechten. Um diese Linie herum spielen Marie Le Pen und Emanuel Macron Katz und Maus, wer die Mitte und wer die Rechte ist, und spalten damit die Nation. Ihre beiden Versuche, sie zu vereinen, führen zu einer starken Polarisierung. Nach dem geltenden Prinzip der Stimmenmaximierung übernimmt die selbsternannte Mitte verbal die populistische rechte Rhetorik und verschiebt die politische Substanz nach rechts, behauptet aber, dass sie besser sei, weil sie aus der Mitte oder aus der Linken komme. Insgesamt findet eine Verschiebung der Normen und der Sprache sowie der politischen Substanz nach rechts statt. Das Thema Einwanderung ist dabei der Auslöser.
Frankreich ist nur eines von mehreren Beispielen. Das Muster lässt sich in der EU beobachten, wo der Vorsitzende der konservativen Parteien im Europäischen Parlament, Manfred Weber (EVP), einen Mittelweg zwischen den Rechtspopulisten und der Linken sucht, wobei die ehemaligen Zentrumsparteien ebenfalls von Webers gemäßigt rechte Fraktion, die sich als die neue Mitte bezeichnet, verdrängt werden. Wenn die gemäßigte, liberal-konservative Rechte versucht, sich als Mitte zu definieren, folgt sie automatisch einer Verhandlungslinie nach rechts, zur extremen Rechten. In dieser Hinsicht spielt Italiens rechtspopulistische Regierungschefin Georgia Meloni nicht nur in Italien, sondern auch in der EU eine Schlüsselrolle. Sie wird auch von der Trump-Regierung geschätzt, die nichts mehr will, als den konfrontativen Rechtspopulismus in Europa zum Mainstream zu machen. [1]
Die Erosion der Demokratie nach 2008 von ihrem Status geringer Intensität hin zu illiberalen, autoritären und paternalistischen Regimes wurde lange Zeit als schleichender Tod beschrieben, selbst während Trump 1 (Levitsky & Ziblatt 2018). Nach sechs Monaten Trump 2 muss man von einem Niedergang in den USA sprechen, der einem Erdrutsch ähnelt. Niemand spricht mehr von einem schleichenden Tod. Es ist diese Situation, mit der sich Europa endlich – selbstkritisch, aber mit Zuversicht – auseinandersetzen muss, ohne vor sich hin zu murmeln. Und sich fragen muss, wie nah es einer amerikanischen Entwicklung ist.
Das nihilistische Problem: das Grenzenlose, das Unmäßige, das Sinnlose, das Wertlose
Nach der Abkehr vom fordistischen Produktionsregime, das auf industrieller Fertigung mit Zeitstudien, Akkordarbeit und Fließbändern als Methoden sowie Investitionen in feste Anlagen (Ziegel und Mörtel) basierte, die Jahrzehnte lang Bestand hatten und Öl als Brennstoff verwendeten, entstand eine monetäre Denkweise. Die lukrative Wertschöpfung der Zukunft lag nicht in der industriellen Güterproduktion, sondern im Handel mit Finanzdienstleistungen. Der Mehrwert lag im Geld selbst, das sowohl der neue Input als auch das Endprodukt war. Mit dieser Sichtweise wuchs der Widerstand gegen die Kontrolle des Handels mit Währungen und anderen Finanzdienstleistungen durch die nationalen Regierungen. Die Forderungen nach einem freien Handel mit Finanzdienstleistungen über nationale Grenzen hinweg nahmen zu. In den 1990er Jahren wurden die Finanzmärkte von ihren nationalen Bindungen befreit, aber diese Liberalisierung hatte bereits in den 1980er Jahren begonnen.
Die Monetarisierung der Wirtschaft wuchs exponentiell, als sich der Motor des Wirtschaftswachstums von Sachanlagen zu Geldportfolios verlagerte. Der Gewinn lag in der Investition in Geld und im Handel mit Geld. Der Maßstab, der die Preisgestaltung im Rohstoff- und Fertigwarenhandel bestimmte, das Geld selbst, wurde zum Gegenstand der Preisgestaltung und erlangte damit einen volatilen Wert. Die Monetarisierung der neoliberalen Ära verwandelte Werte zunehmend in Preise, machte sie relativ, verhandelbar und spekulationsanfällig. Der Eckpfeiler der alten Ordnung, der Goldpreis, verschwand in einem Meer schwankender Werte. Auf dem grenzenlosen Markt wurden sogar die Werte, die die Demokratie stützten, verhandelbar. Nicht nur materielle Werte, sondern auch immaterielle Werte und ethische Prinzipien werden in den nihilistischen Trend hineingezogen, in dem alles einen verhandelbaren Preis hat. Absolute, unbezahlbare Werte bekommen einen Handelswert und werden verhandelbar. Menschenrechte waren nicht so absolut, wie man behauptete. Dies galt nicht nur für die Vereinigten Staaten. Europäische Regierungen und die EU zahlen Bestechungsgelder an skrupellose autoritäre Herrscher südlich des Mittelmeers, damit deren Vertreter sich für die Nihilisierung des europäischen Wertekanons einsetzen. Das Recht auf Asyl hat seinen Preis und ist nicht mehr absolut. Werte werden grenzenlos, exzessiv, sinnlos und wertlos (Stråth und Trüper 2025).
Donald Trump ist das perfekte sichtbare Beispiel für diese Entwicklung, der Mann der Techno-Oligarchen für die Schaffung neuer Werte. Nichts repräsentiert diese Wertschöpfung rund um das Grenzenlose, das Unmäßige und das Sinnlose, das im Wertlosen endet, besser als Trumps KI-Bild von sich selbst als Papst. In seinem beispiellosen Narzissmus glaubt er möglicherweise an das Bild als mögliche Realität, genauso wie er an sich selbst als Friedensnobelpreisträger glaubt, was an sich schon eine Form des Nihilismus ist, bei der man glaubt, dass alles gekauft werden kann. Die Digitalisierung des Handels mit Werten hat diese Entwicklung beschleunigt. Soziale Medien entwickeln eine sich gegenseitig verstärkende Dynamik zwischen der ständigen Schaffung neuer Werte und dem Konsum von Werten (Stråth und Trüper 2025). Link zum Blog 3 BS-HT
Ein wichtiger Aspekt des Nihilismus ist, dass sich Regeln und kulturelle Codes für den öffentlichen Raum und die Repräsentation politischer Macht auflösen. Das Öffentliche wird privat und das Private wird öffentlich. In einem Artikel berichtet der Historiker Christopher Clark von einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz im Weißen Haus im Februar 2025, bei der First Buddy Elon Musk über das neu gegründete DOGE, Department of Government Efficiency, berichten sollte. Clark empfand Entsetzen, als er Musk sah und hörte, wie er zusammenhanglos und ohne Beweise darüber sprach, wie er und sein Team groß angelegten Betrug und grenzenlose Korruption aufgedeckt hätten. Präsident Trump saß in einem dunklen Anzug an seinem Schreibtisch im Oval Office. Musk stand in Jeans und Mantel da, auf dem Kopf eine MAGA-Kappe, die er nur abnahm, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Seine Bewegungen waren ungeschickt, und er sprach, ohne Augenkontakt zu den vor ihm kauernden Journalisten aufzunehmen. Möglicherweise stand er unter dem Einfluss von Ketamin. Er hatte seinen vierjährigen Sohn namens X Æ A ‒Xii mitgebracht. Während sein Vater sprach, bohrte der Sohn in der Nase und schmierte den Nasenschleim zur offensichtlichen Bestürzung des Präsidenten an die Ecke des ehrwürdigen Resolute Desk (Clark 2025). Keiner der Akteure schien in der Lage zu sein, den öffentlichen Charakter der Pressekonferenz zu begreifen. Sie war so öffentlich, wie eine solche Veranstaltung in dem Raum sein kann, der für die meisten Amerikaner mehr als alles andere die Autorität des Präsidentenamtes repräsentiert. Die radikale Informalität, die die beiden Männer und das Kind ausstrahlten, als würden sie sich privat zu Hause treffen, war obszön, schreibt Clark.
Das Beispiel mag extrem sein, aber es steht für einen Trend: den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Ein weiteres Beispiel ist das NATO-Treffen in Den Haag im Juni 2025, bei dem das Kniefällen und Kriechen vor Daddy Donald, wie ihn der Generalsekretär nannte, Ausdruck einer historischen Sinnkrise war. In einer Zeit des Krieges, in der es um existenzielle Fragen zu diskutieren galt, versammelten sich 32 Staats- und Regierungschefs zu einem Treffen, dessen Hauptziel es war, Trump bei Laune zu halten. Mit diesem Ziel vor Augen musste es kurz gehalten werden, nur ein paar Stunden, damit Trumps Aufmerksamkeit nicht nachließ. Alle gratulierten sich gegenseitig, als das Ziel dank des Mangels an Diskussionsstoff erreicht war. Es war eine Hofzeremonie der überdeutlichen Unterwürfigkeit, bei der 31 Staats- und Regierungschefs um das goldene Kalb, den Führer Nummer 1, tanzten. Der Generalsekretär war sichtlich erfreut über seine Rolle als oberster Hofnarr. Das einzige Thema auf der Tagesordnung war die Aufwendung von fünf Prozent des BSP für Verteidigung, aber es handelte sich nicht um eine Frage der Diskussion, sondern um ein Diktat, eine bizarre Zahlenmystik, die Trump aus der Luft gegriffen hatte und die vor dem Treffen ohne substanzielle Diskussion akzeptiert wurde. Wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs so die Sicherheit Europas gewährleisten? Wenn nicht, warum tun sie es dann? Ein Treffen, bei dem der launische Trump ruhig blieb, wird als Bestätigung für die Ernsthaftigkeit des NATO-Engagements der USA verkündet. Wirklich? Warum gab es keinen Erwachsenen im Raum? Rückgrat? Selbstvertrauen und Selbstachtung? Führungsqualitäten? Die Veranstaltung war eine Seifenoper, bei der sich das Publikum nicht mit der Diskussion ernster Themen befasste, sondern mit höfischen Zeremonien und der Interpretation von Zeichen, und bei der in den sozialen Medien anschließend leidenschaftlich darüber diskutiert wurde, ob ein Lächeln tatsächlich ein spöttisches Grinsen war.
Der Glaube an die grenzenlosen Möglichkeiten des Marktes, der in den Boomjahren der 1990er Jahre gestärkt wurde, war verbunden mit einem ebenso starken Glauben an die Möglichkeiten der Gegenwart, als im Zusammenhang mit der Liberalisierung der Finanzmärkte die Kontrolle über die Kreditvergabe an Kreditkartenunternehmen und andere Finanzquellen privatisiert wurde, die Kredite für den sofortigen Konsum gewährten. Die langen Zukunftshorizonte aus der Ära der Planung – als der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg begann und die Sozialstaaten expandierten – verschwanden in einem fernen Dunst, und die Aufmerksamkeit richtete sich auf eine hektische Gegenwart, in der es wichtig war, zu konsumieren, solange die Party dauerte. Sie sollte lange dauern, aber die Gegenwart war aufgrund der Euphorie dennoch hektisch. Das moderne Zeitregime, das die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasste und das Wertesystem zusammenhielt, löste sich auf und ging in einen grenzenlosen Präsentismus über (Hartog 2003; Stråth 2023).
Die neoliberale Interpretationsmacht und Monetarisierung, die Liberalisierung der Finanzmärkte, kombiniert mit der digitalen Macht der sozialen Medien, trieben die Entwicklung in Richtung des Grenzenlosen, des Exzessiven, des Sinnlosen und endeten mit dem Wertlosen in einer Gegenwart, die permanent geworden war. Ein typischer Ausdruck des Unmäßigen und Sinnlosen war die Behauptung des deutschen Bankiers Josef Ackermann, eine jährliche Rendite von 25 Prozent sei der zukünftige Standard für Kapitalinvestitionen und Geldhandel. Er trug sein Ziel wie eine Monstranz vor sich her und verkündete unermüdlich, dass es realistisch sei. Das Ziel war ein Dogma. Das Wissen im Internet war grenzenlos. Die Algorithmen in den Händen der Finanzakteure schufen Werte von bisher unvorstellbarem Ausmaß und trieben das Spiel in den Abgrund, wo beim Zusammenbruch 2008 alles zerstört wurde. Demokratie und Nihilismus passen nicht gut zusammen. Demokratie basiert auf Werten..
Die Macht der Algorithmen
Soziale Medien wurden zu einem hervorragenden Verstärker dieses Präsentismus des Überflusses, in dem die Kommunikation kürzer, schneller und zielstrebiger wurde. Mit Hilfe von Algorithmen entstand eine verdorbene Sprache, in der Feindseligkeit und Emotionen die öffentliche Debatte und den politischen Diskurs auf verheerende Weise veränderten, indem komplexe Themen vereinfacht und abgekürzt wurden. Härte und Emotionen waren in der öffentlichen Debatte sicherlich nichts Neues, aber das Tempo und die Verbreitung waren neu und machten alles komprimierter. In den sozialen Medien liegen die Wurzeln der Infantilisierung und Trivialisierung der Politik, wo jeder Politiker und jede andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens mit Selbstachtung sich berufen fühlt, zu allem, vom Großen bis zum Kleinen, eine Meinung zu äußern, um zu zeigen, dass sie präsent sind. Die Sprache verarmt, wenn Emotionen und intellektuelle Gedanken mit Emojis ausgedrückt werden.
Giuliano da Empoli hat in einem kurzen Essay mit einer historischen Analogie nicht nur erklärt, worum es geht, sondern auch, wie wenig Bewusstsein für die Offensive der Tech-Oligarchen besteht. In den letzten drei Jahrzehnten haben sich die politischen Führer der westlichen Demokratien wie die Azteken verhalten, als sie mit den technologischen Erfindungen der Konquistadoren konfrontiert wurden, schreibt da Empoli. Angesichts des Donners und Blitzes des Internets, der sozialen Netzwerke und der KI haben sie sich unterworfen, in der Hoffnung, dass ein wenig Feenstaub auf sie fallen würde. Ihre Fügsamkeit ist keine Lösung, um das Überleben der Demokratie zu sichern. Nachdem sie vorgaben, die Regeln der Demokratie zu respektieren, solange sie sich in einer unterlegenen Position befanden, zwangen die tech-oligarchischen Konquistadoren den ahnungslosen Azteken nach und nach ihr Imperium in moderner Form auf (da Empoli 2025: 12-13). In Europa existieren noch immer Regierungen als vermeintliches Gegengewicht zur Macht der Technologieplattformen, allerdings mit vagen Ambitionen, diese zu regulieren. In den USA scheint es zu einer Verschmelzung mit der Regierungsmacht gekommen zu sein. Die europäische Demokratie ist ihr nächstes Ziel.
In seinem aphoristischen Stil schildert da Empoli Eindrücke von Treffen auf der ganzen Welt als Berater führender italienischer Politiker und beschreibt, wie schwierig es für Politiker war, die Auswirkungen der digitalen Revolution zu verstehen und anzunehmen.
Aber es gab Ausnahmen. Da Empoli erzählt unter anderem von Henry Kissinger bei einer Konferenz im Jahr 2015, wo Kissinger eigentlich vorhatte, die Sitzung zum Thema künstliche Intelligenz zu überspringen, von der er nichts verstand. Aber mit deutscher Gründlichkeit erschien er trotzdem. Und dort traf ihn der Blitz: Der Gründer von DeepMind stellte eine Software vor, die den Weltmeister im Go-Spiel schlagen würde. Kissinger verstand sofort, dass es um viel mehr ging als um die Digitalisierung eines Brettspiels. Und entgegen seiner Annahme betraf es ihn direkt, in seiner Eigenschaft als „Teilzeit-Historiker und Staatsmann“. Zum ersten Mal, so Kissinger, verliere menschliches Wissen seinen persönlichen Charakter, Individuen würden zu Daten, und Daten würden dominant. KI sei nicht nur ein einfacher Kraftbeschleuniger wie die Politik, sondern eine neue Form der Macht, die sich von allen Maschinen unterscheide, die Menschen bisher erfunden hätten. Wenn es bei der Automatisierung um die Mittel ging, geht es bei der KI um die Ziele. Sie setzt sich ihre eigenen Ziele und entwickelt Fähigkeiten, die man bisher für den Menschen reserviert hielt. Sie trifft strategische Entscheidungen über die Zukunft.
Wo seine jüngeren Kollegen und Verfechter der Demokratie oder Unternehmensoptimisten aus Davos, die wohlwollenden Davos-Männer, noch immer nur eine technische Herausforderung sahen, verstand Kissinger, dass KI eine politische Herausforderung ist. Von den Staatsmännern Kissingers Generation, die in ihrer Jugend den Krieg erlebt hatten, geriet keiner in die Falle, Macht als Wettbewerb zwischen mit PowerPoint-Präsentationen bewaffneten Technokraten zu betrachten, fasst da Empoli seine Eindrücke aus den Treffen zusammen (2025: 126-127).
Das Dilemma, das die Politik des 20. Jahrhunderts geprägt hat, war das Verhältnis zwischen Staat und Markt: Wie viel von unserem Leben und den Funktionen der Gesellschaft sollte vom Staat kontrolliert werden, und wie viel sollte dem Markt und der Zivilgesellschaft überlassen bleiben? Ausgehend davon argumentiert da Empoli, dass die entscheidende Trennlinie im 21. Jahrhundert die zwischen Mensch und Maschine sein wird. Inwieweit sollte unser Leben mächtigen digitalen Systemen unterworfen sein, und zu welchen Bedingungen? Letztendlich müssen Individuen und Gesellschaften entscheiden, welche Aspekte des Lebens der menschlichen Intelligenz vorbehalten bleiben sollen und welche Aspekte der KI oder der Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI anvertraut werden sollen. Und jedes Mal, wenn sie sich dafür entscheiden, den Menschen Vorrang zu geben, obwohl die KI effizientere Ergebnisse hätte garantieren können, wird dies einen Preis haben (da Empoli 2025: 131). Und umgekehrt, könnte man hinzufügen.
Welche Personen sollten also über das Verhältnis zwischen KI und menschlicher Intelligenz entscheiden? Derzeit sind es zweifellos die Tech-Oligarchen, die diese Entscheidung als ihre Aufgabe betrachten. Betrachtet man Vizepräsident Vance als Vertreter der Politik und seine Äußerung auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 (Stråth 2025), so besteht kein Zweifel daran, dass die führenden Vertreter der amerikanischen Politik jedenfalls einer Meinung sind. Da Empoli stellt Kissingers auf einer fundierten historischen Bildung basierende Sichtweise auf KI der Unwissenheit von Mark Zuckerberg gegenüber. „Es ist toll, wieder in Peking zu sein“, schreibt der Facebook-CEO zu einem Foto von sich selbst in Jogginghosen auf dem Tiananmen-Platz, wo im Juni 1989 Tausende von Studenten vom Militär massakriert wurden (da Empoli 2025: 126).
Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass Parlamente und Regierungen die Kontrolle über KI übernehmen und diese regulieren, und zwar entschlossen und mit großer Klarheit. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen daher Stellung gegen die Politik des US-Vizepräsidenten beziehen. Dabei geht es nicht nur um Regeln für KI, sondern auch um die Interaktion im Internet und die Schaffung europäischer Plattformen, Datenspeicher-Clouds, Navigationssysteme (die Grundlage dafür existiert mit Galileo) usw. Es geht auch um die Erkenntnis, dass Zeit ein entscheidender Faktor ist. Schließlich geht es um die Entschlossenheit, sich die Freiheit von US-Zöllen auf Waren nicht durch den Verzicht auf die Regulierung von Algorithmen im Dienstleistungshandel erkaufen zu lassen.
Was nun, Europa?
In der hier beschriebenen Situation ist es an der Zeit, sich Etienne Balibars Argument für ein soziales Europa als Antwort auf die Situation anzuschließen (Balibar 2025). Die Aufgabe besteht darin, nach den historischen Bedingungen für Balibars Vorschlag zu suchen.
In den 1970er Jahren war das Projekt der europäischen Integration schwer umzusetzen. Die Agrarpolitik war fehlgeleitet und die Zollunion reichte nicht aus, um Europas Platz in der Weltordnung zu finden. Die Krise nach dem Zusammenbruch des Dollars warf einen Schatten auf das Projekt. Der französische Präsident Valéry Giscard d’Estaing und der westdeutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt arbeiteten an einer europäischen Währung, die den Dollar ersetzen sollte. Zuvor hatten Edward Heath, Premierminister des Vereinigten Königreichs, das seit 1973 Mitglied der EWG war, und der westdeutsche Bundeskanzler Willy Brandt eine Währungsunion zwischen einer EWG-Währung und dem Pfund skizziert, ein weiter fortgeschrittener Plan als der von Giscard d’Estaing und Schmidt. 1974 wurde Heath von Margaret Thatcher, die völlig andere Vorstellungen hatte, aus dem Amt gedrängt, und Willy Brandt trat zurück, nachdem in seinem Kanzleramt ein ostdeutscher Spion entdeckt worden war (Stråth 2023: 179-180). Der europäische Kairos-Moment als Reaktion auf den Fall des Dollars war vorbei, aber ihre Nachfolger, d’Estaing und Schmidt, arbeiteten weiter in einer eher technokratischen Richtung. Sie luden die Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Japans und Italiens im November 1975 zu einem Treffen in Rambouillet bei Paris ein. Dies war die Grundlage für die G7, die im folgenden Jahr mit dem Beitritt Kanadas gegründet wurde. Giscard d’Estaing und Schmidt wollten vor allem die Zustimmung der USA für eine unabhängigere europäische Währungszusammenarbeit als Ersatz für den schwächelnden Dollar. Kissinger lehnte solche Pläne entschieden ab, aber das Treffen fand eine Lösung für den drohenden Zusammenbruch. Die Währungsfrage wurde beiseite gelegt und man einigte sich auf eine gemeinsame Front der Industrieländer gegen die NIEO-Forderungen der Dritten Welt, der G7 gegen die G77 (Stråth 2023: 109-115).
Die europäische Währungszusammenarbeit drehte sich nun um den Ecu und die Währungsschlange im Schatten eines Dollars, der sich ohne Goldstandard erholte. Aber während der düsteren 1970er Jahre in Europa gab es einen ständigen Strom von Forderungen nach einem engeren Europa. Dieser Strom verlagerte sich von den Währungen zur Vertretung. 1979 wählten die Bürger der neun Mitgliedstaaten zum ersten Mal ihre Vertreter für das Europäische Parlament, das zuvor eine Versammlung von Delegierten war, die von den Regierungen ernannt wurden.
„Der Dollar ist unsere Währung, aber jetzt ist er Ihr Problem“, hatte der US-Finanzminister den Europäern gesagt, als die USA den Goldstandard aufgaben. Der Dollar schwankte frei im Verhältnis zu anderen Währungen, blieb aber mangels Alternativen auch ohne Golddeckung das Wertmaß. Alle anderen Währungen mussten sich anpassen. Das Problem war, dass die Inflation umso stärker anstieg, je schwächer der Dollar wurde. 1979 zog die Federal Reserve die Notbremse mit einer ungewöhnlichen Straffungspolitik, die die Zinsen in die Höhe schnellen ließ, die Reallöhne senkte und die Arbeitslosigkeit erhöhte. Es war die Abkehr der Carter-Regierung von den keynesianischen Ideen. Um Kapitalflucht über den Atlantik zu vermeiden, trat Westeuropa in einen Zinskrieg mit den USA ein, den es schließlich aufgeben musste. Präsident Reagan setzte diesen Kurs fort mit einem stärkeren Dollar, befreit von Zwängen, und einem raschen Abbau des Bretton-Woods-Systems, das in Europa den Rahmen für keynesianische Mischwirtschaften gebildet hatte. In der neuen Ordnung blieb der Dollar unangefochten an der Spitze, ohne andere Garantie als das Vertrauen in ihn, mangels Alternativen, und die Europäer passten sich an. Der Abbau von Bretton Woods ging einher mit einer apologetischen Feier der Theorie des freien Handels mit Waren, Kapital und Dienstleistungen. Deregulierung, freier Kapitalverkehr, Privatisierung, Senkung der Unternehmenssteuern, Verkleinerung des Staatsapparats („Big Government”) und des Sozialstaats (der in den USA trotz Lyndon Johnsons „Great Society”-Programm nie die gleiche Dimension wie in Europa hatte) wurden zu den wirtschaftlichen Instrumenten der Reagan-Ära (Wilenz 2008; Arrighi 2010). Europa folgte diesem Beispiel. Der französische Präsident François Mitterrand und Finanzminister Jacques Delors unternahmen 1981 einen letzten keynesianischen Versuch, die Nachfrage anzukurbeln, wie wir gesehen haben, aber die Angriffe auf den Franc und die darauf folgende Kapitalflucht zwangen sie zwei Jahre später zum Aufgeben.
Als Finanzminister war Delors derjenige, der gezwungen war, eine Sparpolitik umzusetzen, was er so konsequent tat, dass sowohl die britische Premierministerin Margaret Thatcher als auch der westdeutsche Bundeskanzler Helmut Kohl, die beide voll und ganz Reagan folgten, ihn als neuen Anhänger der neoliberalen Theorie betrachteten. Als Mitterrand aus eher persönlichen Gründen Delors 1985 nicht zum Kommissionspräsidenten nominieren wollte, schalteten sie sich ein und überzeugten Mitterrand. Delors war ihre Garantie für ein neoliberales Markt-Europa.
Sie irrten sich gewaltig. Es sollte sich bald herausstellen, dass die französische Sparpolitik keine Frage der Überzeugung war, sondern vielmehr der Erkenntnis, dass die keynesianische Mischwirtschaft in einem Land nicht funktionierte. Aber vielleicht würde sie in einem europäischen Rahmen funktionieren, dachte Delors. Sein Plan war es, eine Alternative zu den Vereinigten Staaten zu entwickeln, die Bretton Woods einseitig gekündigt hatten und mit einem frei schwankenden Dollar frei navigierten, abwechselnd zwischen einem Produktionsimperium und einem Konsumimperium. Delors stellte fest, dass die Vereinigten Staaten ihre Privilegien rund um den Dollar behielten, aber ihre transatlantischen Verpflichtungen aufgegeben hatten, die mit der privilegierten und vorrangigen Stellung des Dollars einhergingen. Schon als Finanzminister hatte er diese Situation kritisiert: Imaginez que la France puisse financer son déficit commercial en créant des francs acceptés par tous, stellen Sie sich vor, Frankreich könnte sein Handelsdefizit finanzieren, indem es einen von allen akzeptierten Franc schafft (Bitumi 2017:7). Er war brutal zu der Erkenntnis gelangt, dass dies nicht möglich war. Aber vielleicht mit Europa?
In einem gut dokumentierten Artikel hat Alessandra Bitumi (2017) untersucht, wie Jacques Delors, der seine politische Ausbildung in der katholischen Arbeiterbewegung erhielt, begann, an einer Erzählung und einer Politik für ein soziales Europa als Gegenpol zu den neoliberalen Vereinigten Staaten des Dollars zu arbeiten.
An seiner Seite als Vizepräsident der neuen Kommission stand 1985 Lord Cockfield, der Finanz- und Handelsminister in der Regierung von Margaret Thatcher gewesen war und seit 1983 von seinen ministeriellen Aufgaben entbunden worden war, um als Ein-Mann-Think-Tank zu fungieren. Als Thatcher Lord Cockfield 1985 zum Kommissar und Vizepräsidenten ernannte, wollte sie damit den ihrer Meinung nach neoliberalen Delors stärken. Thatcher irrte sich auch in Bezug auf Lord Cockfield, der zum Architekten des Binnenmarktes mit seinen vier Freiheiten für Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen wurde, dem Kernelement der Einheitlichen Europäischen Akte, die im Februar 1986 von der EG verabschiedet wurde und wie geplant 1992 zum Vertrag von Maastricht führte. 1985 hatte Lord Cockfield in einem Bericht 300 Maßnahmen aufgelistet, die zur Umsetzung des Binnenmarktes erforderlich waren. Der Binnenmarkt hatte eine soziale Dimension, eine soziale Marktwirtschaft in Europa mit Ideen aus der katholischen Soziallehre und der westdeutschen Sozialmarktlehre.
Der Hintergrund war die neoliberale Erzählung, die immer noch Friedrich Hayek als führenden Bezugspunkt hatte. Hayeks neoliberale Definition von (Markt-)Freiheit hatte wenig mit Laissez-faire zu tun. Hayek war Thatchers Hausphilosoph, aber es waren eher seine politischen Ideen zum Begriff der Freiheit, die sie anzogen, als seine wirtschaftlichen Ideen, die sie weniger verstand. Nach Hayeks Ansicht waren Marktfreiheiten regelbasiert, und in diesem Punkt konnten Delors und Lord Cockfield anknüpfen und vermeiden, als Architekten eines Gegenprojekts wahrgenommen zu werden. Die soziale Dimension sollte in der Formulierung der Regeln zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig begann in den Vereinigten Staaten das Zeitalter Reagans mit einer Hinwendung zum Laissez-faire durch Deregulierung, einem Übergang zum Finanzkapitalismus durch die Aufhebung von Kapitalverkehrskontrollen, der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, Steuersenkungen für Unternehmen und Kürzungen in der Sozialpolitik. Versprechen der Haushaltsdisziplin gingen einher mit schnell wachsenden Haushaltsdefiziten und einer steigenden Staatsverschuldung. Die Widersprüche zwischen Praxis und Rhetorik in der sogenannten Reaganomics waren für jeden offensichtlich, der sie sehen wollte, und standen im Gegensatz zu dem Europa, das Delors aufbauen wollte. Es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass Thatcher diesen Gegensatz erkannte. Entgegen ihren Erwartungen war Delors, unterstützt von Cockfield, nicht der Mann, der den Europäismus in Thatcherismus verwandelte. Es ist unklar, wann Thatcher ihre Fehleinschätzung erkannte, aber Delors unternahm nichts, um seinen Plan zu verbergen. In seinen Reden und Schriften vermittelte Delors seine politische und wirtschaftliche Vision von Europa im Gegensatz zu einem angloamerikanischen Modell einer atomisierten und privatisierten Gesellschaft, die von der Forderung nach Trennung zwischen Staat und Markt unter der Vorherrschaft des Marktes, individualistisch und selbstbezogen geprägt ist. Der Unterschied, den Delors zwischen Europa und den USA sah, bestand in unterschiedlichen Konzeptualisierungen der Bindungen zwischen Individuen in einer Gemeinschaft von Werten und Normen (Bitumi 2017:10). Diese Unterschiede führten zu unterschiedlichen Interpretationen des Freiheitsbegriffs, der Rolle des Staates und der Bedeutung des Marktes. Das normative Ideal, das Delors vor Augen hatte, bestand darin, wirtschaftliche Dynamik mit sozialer Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Eine solche Ordnung sollte in Europa konsolidiert und dann auf die ganze Welt ausgedehnt werden, im Gegensatz zu einer amerikanischen Weltordnung, die einem Fuchs im Hühnerstall glich. Mit diesen Plänen sah sich Delors als Sozialingenieur (Bitumi 2017: 11). Ein stärker integriertes Europa würde die USA in Bezug auf technologische Innovationen einholen und damit auf das reagieren, was Servan-Schreiber zwanzig Jahre zuvor als amerikanische Herausforderung bezeichnet hatte (Servan-Schreiber 1967). Delors’ soziales Europa basierte auf ethischen Prinzipien, die finanzielle Unterstützungsmaßnahmen motivierten, um die Kluft zwischen dem reichen Kern Europas und seiner ärmeren Peripherie zu schließen und das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit zu lösen.
Delors wollte, dass soziale Rechte und Arbeitsmarktstandards Teil der Regeln des Binnenmarktes werden, eine Europäisierung der Regeln durch Harmonisierung. In diesem Punkt gab es einen deutlichen Konflikt mit Thatcher, die sich gegen jede Abgabe nationaler Souveränität im sozialen Bereich aussprach. 1988-1989 erreichte der Konflikt zwischen den neoliberalen und sozialen Visionen eines angelsächsischen und eines „karolingischen” Europas seinen Höhepunkt. Als klar wurde, dass Thatcher die Ernennung von Lord Cockfield zum Kommissar nicht verlängern würde, hielt Delors im September 1988 auf Einladung der britischen Gewerkschaften eine Rede in Brighton, in der er die soziale Dimension in den Mittelpunkt des neuen Europas stellte. Delors forderte Thatcher in ihrem eigenen Land heraus und wies ihre Befürchtungen vor einem Sozialismus durch die Hintertür zurück. Thatcher antwortete zwei Wochen später vom Podium des Collège d’Europe in Brügge aus, das im Wesentlichen Delors’ Heimat war. Sie konzentrierte sich auf Pläne für einen supranationalen europäischen Superstaat, was ein Schuss vor den Bug war, da niemand so etwas befürwortet hatte. Sie distanzierte sich von einem sozialistischen und korporatistischen Europa, das ebenfalls nicht auf der Tagesordnung stand. Das Wall Street Journal kommentierte: „Amerika muss diese Debatte verstehen. Eine Niederlage für Mrs. Thatchers Vision würde sich für die USA als kostspielig erweisen. Schließlich sind neben den Tommies auch einige Amerikaner in ganz Europa begraben“ (Bitumi 2017:14).
Der Maastricht-Vertrag von 1992 über eine Europäische Union, der das Ergebnis der Bemühungen von Delors war, war eine bedeutende Errungenschaft, die die europäische Integration vertiefte. Aber Delors war nicht ganz zufrieden. Die soziale Dimension seines Europas wurde in Maastricht durch Thatchers Widerstand in ein Protokoll zum Vertrag umgewandelt, aber selbst darüber konnten sich die elf Mitgliedstaaten und das Vereinigte Königreich nicht einigen, ohne dass das Vereinigte Königreich einen besonderen Vorbehalt zu diesem Protokoll einlegte. Die Idee der Harmonisierung der sozialen Standards schwebte weiterhin über der Debatte darüber, wie die Union in der Praxis gestaltet werden sollte. Als Delors 1996 die Kommission verließ, einigten sich jedoch alle zwölf Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Klausel, die die Verwässerung der sozialen Dimension bestätigte. Im Einklang mit dem neoliberalen Zeitgeist wurde die Vereinbarung in den Vertrag von Amsterdam von 1997 aufgenommen, der die Idee der Harmonisierung durch neue Formulierungen zu Konzepten wie offenen Koordinierungsmethoden, Benchmarking und bewährten Verfahren ablehnte und damit den Weg für den gegenseitigen Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten und den Druck zur Senkung der Sozialstandards ebnete. Es war diese Entwicklung, die Mario Draghi in seinem Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der EU im Jahr 2024 (EU 2024) kritisierte. Er analysiert, wie die EU einen strukturellen Wandel vom internen Wettbewerb im Binnenmarkt hin zu einer internen Annäherung an Konzepte wie strategische Autonomie, nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiger Wohlstand für eine gestärkte externe Wettbewerbsfähigkeit vollziehen kann. Mit einer expliziten Betonung der sozialen Dimension lässt sich leicht eine Verbindung zu Delors’ Bemühungen um ein soziales Europa herstellen. Die Achse Delors-Draghi wäre ein hervorragender Ausgangspunkt für eine europäische Antwort auf le défi américain 2.0 in Form von Trump.
Zur Frage des Mangels an Alternativen, Mut und der Vision eines demokratischen Europas
Die Politik wurde vom Markt diktiert, es gab keine Alternativen, laut einem neoliberalen Mantra von Thatcher bis Merkel. Der Mangel an Alternativen ist das Herzstück der Demokratie mit geringer Intensität, die zu einer Krise der liberalen Demokratie als solcher geführt hat, wie wir sie aus den keynesianischen Mischwirtschaften der Wohlfahrtsstaaten in Westeuropa während einiger Jahrzehnte seit den 1950er Jahren kennen. Also in einem begrenzten Teil der Welt. Der Niedergang ging einher mit einem Aufschwung illiberaler autokratischer und paternalistischer Regierungsformen, die vom Rechtspopulismus getragen wurden. Vieles ist unklar darüber, wie genau der Niedergang zustande gekommen ist und wie er zu erklären ist, aber einige Faktoren, die dazu beigetragen haben, scheinen klar zu sein. Ein Hauptgrund ist die Überzeugung, dass Politik dem Markt unterworfen ist, weil es eine Überzeugung war/ist. Diese Überzeugung, diese Ideologie, ist eine Unterwerfung, die einen demokratischen Kampf um Alternativen und Entscheidungen zur Gestaltung der Zukunft unmöglich macht. Die geringe Intensität und die Verlagerung von einer interessen- und ideologiegetriebenen Politik hin zu einer technokratischen Suche nach Stimmenmaximierung machten es möglich, an eine demokratische Politik ohne Alternativen zu glauben.
Demokratie erfordert nicht nur ideologie- und interessenorientierte Alternativen, sondern auch Führung. Es reicht nicht aus, zu sagen, dass Demokratie die Macht des Volkes ist, was bedeutet, dass das Volk entscheidet. Bei der Demokratie geht es sicherlich darum, dem Volk zuzuhören, aber genauso geht es darum, durch Visionen und Pläne zur Umsetzung dieser Visionen Ziele zu erreichen. Bei Führung geht es auch darum, Kompromisse zwischen verschiedenen Zielen zu finden, denn das Volk ist nicht eins, sondern viele mit unterschiedlichen Zielen. Zuhören, Führen, Kompromisse eingehen und Regieren sind die Zutaten für eine lebendige Demokratie. Populistische Führer hören ebenfalls zu, aber um Stimmen für Ziele zu gewinnen, die sie selbst definieren. Die stimmenmaximierenden Parteikartelle hören zu, aber es fehlen ihnen klare Ziele. Sie lassen sich eher von dem leiten, was sie hören, als von dem, was sie kontrollieren. Das Bewusstsein für diese Unterschiede ist in wichtigen Punkten verloren gegangen. Es ist wichtig, es wiederherzustellen.
Es gibt zunehmend Forderungen nach Mut in der Politik. Es wird argumentiert, dass wir in einem postheroischen Zeitalter leben (Münkler 2007). Dabei geht es natürlich nicht um militärischen Mut auf dem Schlachtfeld in Kriegszeiten, sondern um den intellektuellen Mut, Verantwortung für große und schwierige Entscheidungen zu übernehmen, zu ihnen zu stehen und alles zu tun, um sie umzusetzen. Demokratie braucht Führungskräfte mit intellektueller Autorität, Vorstellungskraft und Charisma. Und die Fähigkeit, Verantwortung für Niederlagen zu übernehmen und aus ihnen zu lernen.
Dies ist ein Argument, das weiterer Untersuchung bedarf, aber schwer zu widerlegen ist: Mit dem Mangel an Alternativen als Credo hat eine ganze Generation von Politikern das Credo, das Ethos und den Habitus verloren, die die demokratische Politik bis in die 1980er Jahre geprägt haben. Es scheint einen Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Weltordnung des Kalten Krieges und der Euphorie zu geben, die durch leichtfertige Gedanken an eine problemlose Zukunft ausgelöst wurde. Zu dieser Zeit setzte sich auch die neoliberale Erzählung vom Mangel an Alternativen unter dem Diktat des Marktes durch. Als diese Erzählung in der Spekulationsblase von 2008 zusammenbrach und das Motto für den Mangel an Alternativen in der Politik unter dem Diktat des Marktes zu „too big to fail“ mit gigantischen staatlichen Interventionen wurde, fühlten sich viele betrogen. Nach 2008 gelang dem Rechtspopulismus und dem illiberalen autokratischen Paternalismus der Durchbruch, der sich gegen die neoliberalen „Kosmopoliten” und „Globalisten” richtete, aber die Kritik am neoliberalen Projekt hatte in den USA bereits um das Jahr 2000 begonnen, wie wir gesehen haben (Stråth 2025). Die Überzeugung, dass es keine Alternativen gibt, hat diese Entwicklung begleitet und es unternehmungslustigen politischen Akteuren ermöglicht, diesem Mangel an Alternativen eine autoritäre und nationalistische Form zu geben.
Diese Entwicklung, die nun immer deutlicher wird, erschien bis vor kurzem noch viel vager. In den USA war von einem schleichenden, heimtückischen Tod der Demokratie die Rede (Levitsky und Ziblatt 2018). Es gibt keinen klaren Punkt, an dem man Widerstand leisten kann. Die Menschen folgen mit unangenehmen Gefühlen in einer Zwielichtlandschaft, ohne zu wissen, was sie tun sollen, bis alles umkippt und es zu spät ist, wenn die schräge Ebene den Erdrutsch auslöst. Dort befanden sich die USA im Januar 2025. Vor dieser Entwicklung warnt Habermas (Habermas 2025; vgl. Stråth 2025) und fordert die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, sich zu erheben und sie zu stoppen, bevor sie zu weit geht. Trump hat keine wohltätigen Motive, sondern nur seine eigenen Interessen, die er auf zynische und rätselhafte Weise definiert. Es gibt eine Kluft zwischen dem, was er sagt, und dem, was er tut. Es wäre jedoch ein schwerwiegender Fehler, Trump als etwas einzigartig Amerikanisches zu betrachten, das in Europa nicht passieren kann. Die Trump-Regierung und die Tech-Oligarchen sind mit etwas sehr Großem beschäftigt, nämlich der Umstrukturierung der Weltordnung durch eine systematische und bewusste Ausweitung der Exekutivgewalt auf Kosten der parlamentarischen Gewalt. Unabhängig davon, ob die Umstrukturierungspläne, die nicht unbedingt sehr konkret sind oder von der Führung einstimmig unterstützt werden, erfolgreich sind oder in globaler Anarchie enden, werden Europa und die Bedingungen für Demokratie in Europa stark davon betroffen sein.
In Ermangelung systematischer Forschung ist dies eher eine Hypothese als ein Argument: Politiker, die keine Alternativen anbieten, sind zu Aposteln der Hilflosigkeit geworden. Die politische Mitte ohne Alternativen ist zur Mitte der Hilflosigkeit geworden, in der sich alle drängen, aber nicht wahrhaben wollen, dass sie nach rechts gezogen werden, wo kreative Politik stattfindet. Sie merken nicht oder wollen nicht merken, dass die Kreativität in die falsche Richtung geht. Es braucht eine neue Mitte, mit Konflikten und Kompromissen zwischen sozialdemokratischen, sozialliberalen und sozialkonservativen Alternativen. Die Frage der Verteilung muss wieder als Konflikt thematisiert werden, mit dem Ziel, Kompromisse zu finden. Der Mythos, dass der Markt den Konflikt automatisch und harmonisch für alle löst, muss zurückgewiesen werden. Der Konflikt um die Verteilung muss wieder sichtbar werden, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch global. Es ist nicht mehr möglich, so zu tun, als gäbe es ihn nicht. Es muss ein neues Mittelfeld geschaffen werden, das sich vom Neoliberalismus distanziert, der zusammengebrochen ist und nichts mehr zu bieten hat als Zerstörung, ohne Gedanken darüber, was nach der Zerstörung passieren wird oder was genau zerstört werden soll und warum. Ein neues Mittelfeld, das sich auch vom sozialen Nationalismus mit der Geschichte als Zukunft distanziert, bei dem die Erbauer auf der rechten Seite die Augen davor verschließen, wie leicht sozialer Nationalismus zu Nationalsozialismus mutiert, indem sie entweder die Augen verschließen oder dies sogar wünschen.
Die Unterscheidung zwischen Konsum und Investition ist in der Haushaltsdoktrin, die aus der Reagan-Ära stammt, verloren gegangen. Nach dieser Ideologie stimulieren Steuersenkungen für die oberen Einkommensschichten die Wirtschaft und bringen die Räder wieder ins Rollen, wenn sie zu stehen drohen. Die Doktrin war die Antwort der angebotsorientierten Ökonomen auf die keynesianische Nachfragestimulierung, die eine verteilungspolitische Ambition hatte. Das Thema Verteilung ist auch im Reaganismus präsent, jedoch nicht als Problem, sondern als Bonus, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben, wie Thomas Piketty (2014) ausführlich dargelegt hat. Der Reaganismus löste und löst das Verteilungsproblem mit der Pferdemisttheorie: Ein paar Körner Hafer bleiben für die Spatzen, die Armen, übrig. In einer appetitlicheren Metapher wird diese Idee als Trickle-down-Effekt bezeichnet. Keynes verstand den Unterschied zwischen der Stimulierung der Nachfrage in einer rückläufigen Wirtschaft und der Stimulierung der Inflation, wenn die Methode zur Lösung struktureller Probleme eingesetzt wurde. Als Keynes’ Anhänger dies während der Strukturkrise der 1970er Jahre nicht verstanden, kam es zu dem überraschenden Phänomen der Stagflation. Auch neoliberale Denker haben den Unterschied zwischen Konjunkturzyklus und Struktur aus den Augen verloren, wenn sie für Steuersenkungen argumentieren. Sie ignorieren den Unterschied zwischen Konsum und Investitionen, wenn sie die Notwendigkeit eines ausgeglichenen Haushalts in allen Situationen betonen. Wenn Steuersenkungen zu Defiziten führen, werden diese als vorübergehend bezeichnet. Langfristig würden sich Steuersenkungen selbst finanzieren, sagen sie. Diese Fragen müssen erneut diskutiert werden, indem die grundlegenden Widersprüche offengelegt werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine lebendige Demokratie.
Es bedarf einer neuen Wirtschaftstheorie, um die großen existenziellen Probleme im Zusammenhang mit dem Klima und der Umwelt sowie der globalen Verteilung der Ressourcen und Einkommen auf der Erde zu lösen. Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern alte Probleme neu zu denken. Die Ökonomin Mariana Mazzucato (2021) will die wirtschaftlichen Grundlagen für den heutigen Mangel an politischem Handeln und Governance in der Wirtschaft verändern. Ihr Buch Mission Economy liefert leidenschaftliche und überzeugende Argumente für eine neue Sichtweise auf Politik und Wirtschaft, die den neoliberalen Mangel an Alternativen hinter sich lässt. Ihre Fallstudie ist der russische Spionagesatellit Sputnik aus dem Jahr 1957, der Schockwellen durch die Vereinigten Staaten sandte und zum Apollo-Projekt der Kennedy-Regierung führte, das auf der Entscheidung beruhte, innerhalb von zehn Jahren einen Menschen auf dem Mond zu landen. Mazzucato beschreibt, wie die Regierung die Führung bei dem Projekt übernahm, Industrie, Forschungseinrichtungen und Medien mobilisierte und koordinierte, Zwischenziele ohne Top-down-Kontrolle diskutierte und alle dazu brachte, auf das Ziel hinzuarbeiten. Der Punkt war politische Führung, die Engagement von unten schuf. Sie zeigt, dass Industrie und Wirtschaft nicht nur eine Frage der Gewinne für Aktionäre sind, sondern dass es auch öffentliche Interessen mit verschiedenen Interessengruppen gab, im Gegensatz zu Aktionären. Diese Interessen miteinander in Einklang zu bringen, war Teil der politischen Koordination. Diese Koordination erfordert langfristiges Denken, das ständig im Auge behalten und aktualisiert werden muss. Mazzucatos Modell durchdringt die Wirtschaft mit Visionen, Organisation, Ambitionen und öffentlichem Interesse – Eigenschaften, die in der Geldwirtschaft mit ihren kurzfristigen Gewinninteressen und Spekulationen verschwunden sind. Anstatt einen imaginären festen Haushaltsspielraum zum Ausgangspunkt der Politik zu machen, plädiert Mazzucato dafür, mit einer Vision der Zukunft und der Politik zur Umsetzung dieser Vision zu beginnen und von dort aus den finanziellen Spielraum für das politische Ziel zu schaffen. Wie beim Apollo-Projekt. Das Modell und das dahinterstehende Denken passen sehr gut zu Delors’ Arbeit für ein soziales Europa. Die Herausforderung, die Mazzucatos Buch aufwirft, ist die Frage, warum große Projekte so oft einen militärischen Ursprung und Zweck haben. Warum sind sie so oft in großen existenziellen Fragen im Zusammenhang mit Waffen verankert? Ein soziales Europa und ein Planet mit einem für das Überleben geeigneten Klima sind ebenfalls hochgradig existenzielle Fragen. Mazzucatos Buch ist während der Pandemie viel zu leicht und zu schnell in Vergessenheit geraten. Es verdient es, durch eine eingehende Debatte darüber, wie seine Ideen umgesetzt werden können, sehr ernst genommen zu werden. Wenn die Ideen des Buches zum Mainstream werden, könnten auch radikalere Vorschläge für die Wirtschaft der Zukunft in die öffentliche Debatte einfließen (Quilligan und Stråth 2025).
Moralismus ist kein gutes Prinzip für politisches Handeln, aber in der nihilistischen Marktära, in der es keine Alternativen gibt, wurde vergessen, dass ohne ethische Werte und Moral, ohne Normen, regelbasierte Politik und demokratische Politik nicht funktionieren. Jacques Delors wusste dies in seiner Arbeit für ein soziales Europa. Er wagte es, eine große Vision zu entwerfen und dafür einzustehen. Er wagte es, Verantwortung für eine Politik zu übernehmen, die ein rein marktorientiertes Europa korrigierte und ergänzte. Er wollte ein Europa schaffen, das mehr war als ein À-la-carte-System, in dem sich jeder die Rosinen herauspicken konnte, die ihm Vorteile verschafften, aber nicht bereit war, Kompromisse und Opfer zu bringen, um ein gemeinsames Europa zu bilden. Um die Entwicklung zu verhindern, die das Trump-Regime vorangetrieben hat, eine Weltordnung, die sich von der heutigen entfernt und zu etwas anderem führt, sei es nun globale Anarchie oder der Triumph der Algorithmen, braucht es ein anderes Europa. Ein anderes Europa, dessen Führer Verantwortung füreinander übernehmen in einer europäischen Schicksalsgemeinschaft. Wenn die Länder im Norden der Meinung sind, dass die Verteidigung gegen die Bedrohung aus dem Osten wichtig ist, müssen sie sich fragen, was Mitglieder wie Italien, Spanien und Portugal dazu bewegen kann, sich einbezogen zu fühlen. Vielleicht wäre eine gemeinsame Flüchtlings- und Einwanderungspolitik mit gemeinsamer Verantwortung für das sogenannte Schengen-System eine Möglichkeit. Aber eine wertebasierte Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, die sich völlig von der derzeit praktizierten unterscheidet. Dies wiederum erfordert Führungskräfte, die es wagen, visionär zu denken und Verantwortung für ihre Ideen zu übernehmen. In diesem Zusammenhang könnte Delors mit Hilfe von Mario Draghi als Vorbild für den Aufbau eines Europas dienen, das globale, planetarische Verantwortung für sich selbst und für die Welt übernimmt, anders als es die europäischen Mächte unter den Konzepten des Kolonialismus und Imperialismus getan haben. Mit anderen Worten: Europa als Gegenpol zu den heutigen Vereinigten Staaten. Ein dritter Artikel unter der Überschrift „Eine Weltordnung in Auflösung” wird diesen Gedanken weiterentwickeln.
Letztendlich ist die Frage des Tages eine Frage der Führung. In einer Zeit, in der autokratische und paternalistische Ideale den Führungsstil zu prägen scheinen, wäre es wichtig, eine Debatte über Werte und Normen zu führen, die auf zwei Problemen basiert: der Frage des menschenwürdigen Zusammenlebens auf dem Planeten Erde und den Möglichkeiten und Risiken von Algorithmen sowie natürlich der Macht über sie. Eine Ausweitung der Debatte in diese Richtung führt automatisch zu einer Verbindung mit der existenziellen Klima- und Umweltfrage. Die übergeordnete Frage ist natürlich, ob die Demokratie gerettet werden kann. Bei dieser Frage geht es darum, die Welt so zu sehen, wie sie ist, ohne die Frage zu vergessen, wie sie sein sollte. Ausgangspunkt muss die Erkenntnis sein, dass Geschichte nicht vorbestimmt ist, sondern durch menschliches Handeln oder Nicht-Handeln geschaffen wird. Die Aufgabe besteht darin, neue Perspektiven und einen neuen Diskurs über die Zukunft zu entwickeln, weg vom Mangel an Alternativen und den Diktaten des Marktes. Der Diskurs schafft den Rahmen für das Handeln. Die Führung folgt dem Diskurs und gestaltet und entwickelt ihn gleichzeitig.
Übersetzung von DeepL und Bo Stråth aus dem Schwedischen des Artikels Bo Stråth, “En världsordning i upplösning. Vad nu? 2. Den lågintensiva demokratin utan alternativ, nihilismen och algoritmerna.” Statsvetenskaplig Tidskrift Vol 128 Nr 3 September 2025.
Endnote
[1] Meloni könnte einen neuen politischen Stil repräsentieren, der die Kluft zwischen gemäßigtem liberalem Konservatismus und Rechtspopulismus überbrückt. Trotz ihrer Wurzeln in der neofaschistischen Bewegung folgt sie nicht wirklich dem rechtspopulistischen autoritär-paternalistischen Muster, auch wenn es Anzeichen in diese Richtung gibt, wie beispielsweise die Umstrukturierung der RAI, der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalt. Sie bildet keine Einheitsfront mit Lega-Chef Matteo Salvini, dessen rechtspopulistische Partei Teil der Regierungsbasis ist, was sich in ihrer moderateren Haltung zur Einwanderung als Salvini und ihrer Distanzierung vom Putin-freundlichen Lega-Chef durch ihre Unterstützung für die Ukraine zeigt. Sie hält Salvini auf Distanz. Die Frage ist, ob sie tatsächlich versucht, eine Lücke zu füllen, die durch den Zusammenbruch der italienischen Christdemokratischen Partei in den 1990er Jahren entstanden ist – eine Lücke, die auch Berlusconi zu füllen versuchte, ohne wirklich Erfolg zu haben. In ähnlicher Weise balanciert Meloni auch zwischen der moderaten und der extremen Rechten in Europa. Dieses Beispiel zeigt, wie komplex die Politik der Rechten ist. Es ist klar, dass sich der politische Schwerpunkt nach rechts verschoben hat, aber die Auswirkungen sind nicht so klar.
Fortsetzung folgt:
“Eine Weltordnung in Auflösung. Was nun? 3. Ein wertebasiertes Europa in einer nihilistischen Zeit. Auf dem Weg zu einem Nomos für eine globale Gesellschaft.” Dezember 2025
Referenzen:
Arrighi, Giovanni, 2010. „The World Economy and the Cold War, 1970-1990”, in Leffler, Melvyn P. & Westad, Odd A., (Hrsg.) The Cambridge History of the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, Band 3: 49. Zitiert aus Bitumi 2017:8.
Balibar, Etienne 2025. ”Die unmögliche Möglichkeit einer europäischen Föderation: gestern, heute, morgen” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/die-unmogliche-moglichkeit-einer-europaischen-foderation/ Published 30.07.2025
Bitumi, Alessandra, 2017. “Narrating Social Europe. The Search for Progress in the ‘Age of Delors.’” Notre Europe Policy Paper, 27. Januar.
Clark, Christopher, 2025. „Ist Trump Faschist?“ Süddeutsche Zeitung, 27. Juni.
Crouch, Colin, 2009. “Privatised Keynesianism: An Acknowledged Regime?“, The British Journal of Politics and International Relations 11(3), S. 382-399.
Crozier, Michel J., Huntington, Samuel P. & Watanuki, Joji, 1975. The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracy to the Trilateral Commission. New York: New York University Press.
van Eeden, Pepijn, 2019. “Discover, Instrumentalize, Monopolize: Fidesz’s Three-step Blueprint for a Populist Take-over of Referendums“, East European Politics and Societies 33(3), S. 3.
Da Empoli, Giuliano, 2025. L’heure des prédateurs. Paris: Gallimard.
EU, 2024. Der Draghi-Bericht. A und B. Brüssel: Europäische Kommission.
Gustavsson, Rolf, 2010. Sveriges statsmiknistrar under 100 år: Ingvar Carlsson. Stockholm: Albert Bonniers.
Habermas, Jürgen, 2025. „Für Europa“, Süddeutsche Zeitung, 21. März 2025.
Hanson, Stephen E. & Kopstein, Jeffrey S., 2024. The Assault on the State. How the Global Attack on Modern Government Endangers Our Future. Cambridge: Polity Press.
Hartog, François, 2003. Des régimes d’historicité: Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil.
Lang, Andrew, 2011. World Trade Law After Neoliberalism: Re-Imaging the Global Economic Order. Oxford: OUP
Levitsky, Steven & Ziblatt, Daniel, 2018. This is how democracies die. Penguin Books.
Lewis, Michael, 2018. The Fifth Risk: Undoing Democracy. WW Norton & Company.
Mair, Peter, 2013. Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy. London: Verso.
Marks, Susan, 2000. The Riddle of All Constitutions: International Law, Democracy, and the Critique of Ideology. Oxford: Oxford University Press.
Mazzucato, Mariana, 2021. Mission Economy. A Moonshot Guide to Changing Capitalism. London: Allen Lane.
Moyn, Samuel, 2010. The Last Utopia. Human Rights in History. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Moyn, Samuel, 2018. Not Enough Human Rights in an Unequal World. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Münkler, Herfried, 2007. „Heroische und postheroische Gesellschaften“, Merkur Nr. 700, September.
Quilligan, James & Stråth, Bo, 2025. „The Value of Energy. Drei Gespräche zwischen Bo Stråth und James Quilligan.” Blog https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/the-value-of-energy-conversations-with-james-quilligan Veröffentlicht am 04.01.2025.
Piketty, Thomas, 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rodrik, Dani, 2000. “How Far Will International Economic Integration Go?“ Journal of Economic Perspectives 14, S. 177–186.
Servan-Schreiber, Jean-Jacques, 1967. Le défi américain. Paris: Versilio.
Stråth, Bo, 2023. The Brandt Commission and the Multinationals. Planetary Perspectives.. London: Routledge.
Stråth, Bo, 2024. “Where did the future go, and can it be reshaped?”, S. 269–290 in Steine, Bjørn Arne, Brandal, Nik & Nordhagen, Morten (Hrsg.), From Barks to Quisling. Festschrift for Øystein Sørensen. Oslo: Dreyers forlag. Englische Version „Where did the future go, and can it be reshaped?“ Blog https://bostrath.com/planetary-perspectives/ordering-of-space-and-time/where-did-the-future-go/ Veröffentlicht am 17.09.2024.
Stråth, Bo, 2025. En världsordning i upplösning? 1. Imperiernas möte i Europa och Europas svar.“ Statsvetenskaplig Tidskrift, Bd. 127, Nr. 2.
Stråth, Bo & Trüper, Henning, 2025. “Conceptualising Capitalism: Conversations with Henning Trüper. Blog 4. Die Zeitgeist of Empire and Nihilism in Historical Perspective. And Caåpitalism?“ Verfügbar unter https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/conceptualizing.
Varoufakis, Yanis, 2011. Global Minotaur: America, Europe and the Future of Global Economy. London: Zed Books.
Wilentz, Sean, 2000. The Age of Reagan, 1974-2008. New York: Harper Collins.
Wie man zitiert:
Cit. Bo Stråth, “Eine Weltordnung in Auflösung. Was nun? 2. Demokratie geringer Intensität ohne Alternativen, Nihilismus und Algorithmen
” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/eine-weltordnung-in-auflosung-was-nun-2/ Published 19.09.2025.
Comments
Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.