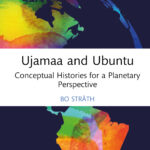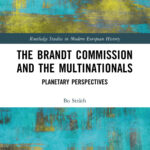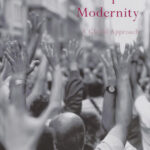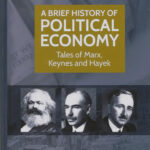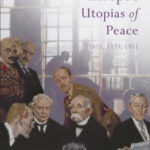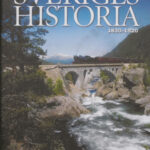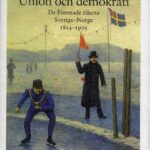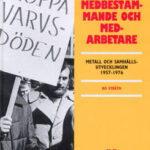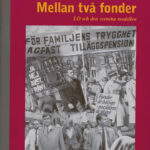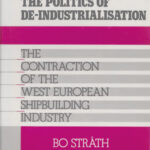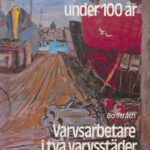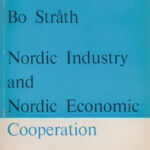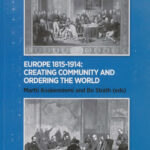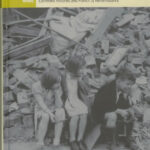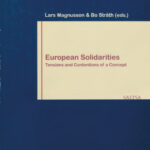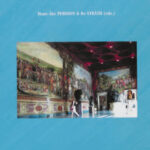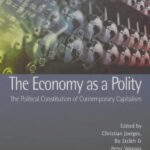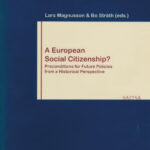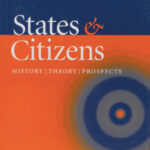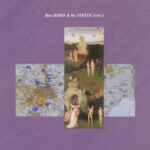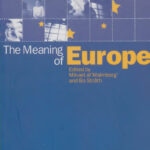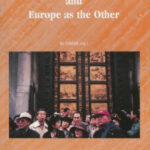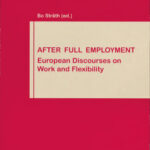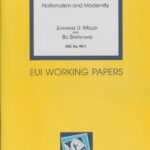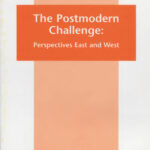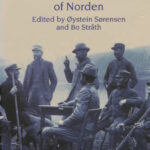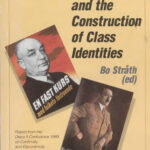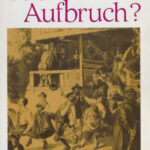Transatlantische Beziehungen: eine kurze Geschichte seit 1945
1945 stieg die USA zur weltweit führenden Macht auf. Anders als nach dem Ersten Weltkrieg kamen der Präsident und der Kongress nun zu dem Schluss, dass das Land eine Weltmacht war, und handelten entsprechend. Sehr bald tauchte die Sowjetunion als Herausforderer dieser Position auf, und die USA nahmen den Fehdehandschuh auf. In einer Situation, in der sich die europäischen Imperien selbst zerstört hatten, teilten die beiden verbliebenen Imperien Europa unter sich auf. Der Marshallplan von 1947 läutete eine neue Phase in den transatlantischen Beziehungen ein, die intensiver als zuvor war und von deutlicheren Führungsansprüchen der USA geprägt war, alles vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Das Militärbündnis NATO, dem 1955 auch Westdeutschland beitrat, unterstrich die militärische Ausrichtung der Beziehungen. Der Koreakrieg von 1950-53 verstärkte diese während der nuklearen Pattsituation der 1950er Jahre.
Nach den damit verbundenen Krisen in Kongo, Berlin und Kuba in den Jahren 1960–62, die rückblickend als Höhepunkt der nuklearen Bedrohung erscheinen, waren sie jedoch nie über einen längeren Zeitraum hinweg harmonisch. Charles de Gaulle misstraute offen dem Dollar als Weltwährung und den USA als Weltmacht. Frankreich verließ den militärischen Teil der NATO. Die Aufgabe des Goldstandards des Dollars 1971–73 verschlechterte die Beziehungen weiter. Die Euphorie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion veränderte die Bedingungen für die transatlantische Zusammenarbeit. Die globale Perspektive rückte in den Vordergrund. Daran änderte auch der 11. September 2001 nichts, der den Traum vom Ende der Geschichte und einer einzigen liberalen Welt, wie sie Francis Fukuyama (1992) entworfen hatte, beendete. Samuel Huntington (1996) hatte Fukuyamas Weltbild bereits einige Jahre zuvor abgelehnt, als er die Zukunft als einen Kampf der Kulturen beschrieb. Der Angriff auf die Twin Towers schien Huntingtons These zu bestätigen und führte zu einer moralistischen neokonservativen Welle mit einem Kampf für Demokratie und westliche Werte in der ganzen Welt. Der Irakkrieg 2003 war der Höhepunkt der Kampagne, die einen Keil in die europäische Zusammenarbeit trieb. Wie allgemein bekannt ist, war es ein Krieg, der mit Lügen gerechtfertigt wurde. Verteidigungsminister Donald Rumsfeld teilte Europa herrisch in das alte Europa, das sich weigerte, am Krieg teilzunehmen, und das neue Europa, das sich der ”Koalition der Willigen” für die Treibjacht auf Hussein anschloss. Robert Kagans Buch Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order (2003), in dem er die USA als Mars und Europa als Venus bezeichnete, brachte die starken transatlantischen Spannungen zum Ausdruck, die sich auch innerhalb Europas ausbreiteten. Formal war die NATO nicht beteiligt. In dieser turbulenten Zeit mit transatlantischen Spannungen gab es jedoch im Gegensatz zu den transatlantischen Spannungen eine Entspannung zwischen Russland und dem Westen. Das neue Russland wurde 1994 durch die Partnerschaft für den Frieden und 2002 durch den NATO-Russland-Rat mit der NATO verbunden. Während der Phase des gegenseitigen Verständnisses in den Beziehungen zu Russland wurde die NATO zunehmend zu einer internationalen Kraft für robuste polizeiliche/militärische Interventionen in lokalen Konflikten weltweit und immer weniger zu einer Invasionsabwehrmacht. Im Rahmen des gegenseitigen Verständnisses wurden Polen, die Tschechische Republik und Ungarn 1999 NATO-Mitglieder. Die baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Slowenien folgten 2004, im selben Jahr, in dem die meisten osteuropäischen Länder der EU beitraten. Der Konsens über diese NATO-Erweiterung hielt jedoch nur kurz an. Russland hatte seit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums ein kompliziertes Verhältnis zu Georgien. Eine starke Bewegung in Georgien wollte das Land näher an den Westen, an die EU und die NATO heranführen. Mit dem eindeutig westlich orientierten Präsidenten Saakaschwili bekam diese Bewegung ein Gesicht. Die immer deutlicher werdenden Ambitionen des Präsidenten wirkten sich negativ auf die Beziehungen zwischen der NATO und Russland aus, die sich ab 2006 spürbar verschlechterten. Im Februar 2007 hielt Putin auf der jährlichen Sicherheitskonferenz in München eine viel beachtete Rede, in der er sich klar von der neuen Weltordnung distanzierte, die er als monopolistisch bezeichnete. Es war klar, wen er mit monopolistischen Ambitionen bezichtigte. Im Mai 2007 nahmen die USA Gespräche mit den Regierungen in Warschau und Prag über die Stationierung von Raketen in Polen und damit verbundenen Radaranlagen in der Tschechischen Republik auf. Georgiens Pläne, der NATO beizutreten, führten 2008 zum Krieg in Georgien. Die Euromaidan-Proteste in der Ukraine von November 2013 bis Februar 2014 waren ein Protest gegen die Entscheidung der pro-russischen Regierung, kein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen. Die Proteste endeten mit der Flucht des Präsidenten und der Reaktion Russlands mit militärischer Infiltration im Donbass und der Annexion der Krim.
Die wachsenden Spannungen zwischen Russland und der NATO um die Macht im Kaukasus und in der Ukraine stärkten nach 2014 vorübergehend die transatlantischen Beziehungen. Mit Donald Trump im Weißen Haus von 2017 bis 2021 nahmen die Spannungen jedoch wieder zu, insbesondere über die Finanzierung der militärischen Zusammenarbeit, bei der die USA ursprünglich der klarste Geldgeber waren. Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 verstärkte den Geist der Zusammenarbeit, aber mit Trumps Rückkehr an die Macht im Januar 2025 vertiefte sich die Kluft zwischen den Atlantikstaaten mehr denn je, während Trump sich Russland annäherte.
Die westliche Ordnung nach 1945, in deren Zentrum die USA standen, ist tot. Seit 1949 war die NATO der Eckpfeiler dieser Ordnung, die eine zentralere Rolle spielte als die Bretton-Woods-Institutionen, der IWF und die Weltbank. Das Wesen der NATO ist in Artikel 5 über gegenseitige Beistandspflicht verankert. In einer Notsituation kann dieser Artikel nicht rechtlich geprüft werden, sondern ist moralisch und basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Trump hat dieses Vertrauen untergraben, indem er den Artikel zu einer Frage gemacht hat, ob die Trump-Regierung der Ansicht ist, dass die europäischen Mitglieder genug für ihre Selbstverteidigung bezahlt haben. Seit 2014 ist klar und seit Februar 2022 mit Nachdruck unterstrichen, dass die Bedrohung der NATO von Russland ausgeht. Dies wird gesagt, ohne auf die heiß diskutierte Frage einzugehen, ob die NATO aus russischer Sicht nach 1990 eine Bedrohung für Russland darstellte, aber mit der Feststellung, dass diese Debatte jedenfalls keine Grundlage für den Angriff Russlands auf die Ukraine liefert. Nach dem umfassenden Angriffskrieg im Februar 2022 wurde die NATO in strategischen Überlegungen und Planungen zunehmend wieder als das reaktiviert, was sie von Anfang an war: eine Invasionsabwehr. Trumps Annäherung an Russland hinter dem Rücken Europas hat noch mehr als die finanzielle Kontroverse über die Höhe der Verteidigungsausgaben den Zerfall des sogenannten Westens deutlich gemacht. Die NATO besteht formal weiter, aber Europa teilt die Bedrohungsanalyse der USA nicht.
Die Lage im Frühjahr 2025
Seit Trumps zweiter Amtseinführung gibt es eine Fülle von Kommentaren, die den Zerfall der Weltordnung kommentieren und Erklärungen in und jenseits von Trump selbst suchen, sowohl langfristig als auch kurzfristig. Ziel ist es hier nicht, die Debatte zusammenzufassen, sondern einige Argumentationslinien als Grundlage für eine Diskussion darüber zu identifizieren, was geschieht und warum. Es ist eine historische Ironie, dass die Gemeinschaft um das Konzept des Westens, das vor fast 80 Jahren von einem amerikanischen Präsidenten geschaffen wurde, nun von einem anderen amerikanischen Präsidenten auseinandergerissen wird. Eine fast achtzigjährige transatlantische Weltordnung – nicht länger, aber auch nicht kürzer – eine Geschichte von Truman bis Trump wird bewusst, momenthaft und mit der Brechstange zerstört. Mit Präsidialverordnungen und öffentlichen Erklärungen, die oft kurz und drastisch in den sozialen Medien veröffentlicht werden, prägt Trump die öffentliche Meinung und schafft Tatsachen, die den Kongress umgehen und Gerichtsentscheidungen provokativ missachten. Die Politik beschleunigt und vereinfacht komplexe Zusammenhänge. Sie weckt starke Emotionen und wird polemisch. Es geht um die Wiedererlangung der verlorenen Größe Amerikas (MAGA, Make America Great Again). China und Europa/die EU werden als Hauptursachen dargestellt. Während China mit einem gewissen rhetorischen Respekt behandelt wird, ist die Kritik an Europa ungehemmter. Die Eröffnungssalve von Vizepräsident J. D. Vance auf der jährlichen Sicherheitskonferenz in München am 14. Februar 2025 (White House, 2025-02-14) löste in Europa Erstaunen, Schock und Wut aus. In konfrontativer Manier behauptete Vance, Europa sei nicht demokratisch genug. Zwei Dinge würden Europa vom Vorbild USA unterscheiden, und in diesen Bereichen forderte er Verbesserungen. Europa gehe schlecht mit rechtspopulistischen Parteien um. Diese müssten klar und eindeutig in die parlamentarische Politik eingebunden werden. Der zweite Punkt betraf Einschränkungen der Freiheit digitaler Plattformen. Diese Einschränkungen seien Ausdruck undemokratischer Mängel in der Meinungsfreiheit, die korrigiert werden müssten. Trumps wiederholte territoriale Ansprüche auf Grönland, Kanada und den Panamakanal mit Androhung der Annexion waren eine offene Herausforderung des Völkerrechts, die den Eindruck eines gewünschten Bruchs mit der seit 1945 bestehenden Weltordnung verstärkten. In zwei Fällen richteten sich die Ansprüche gegen Länder, die seit der Gründung der NATO im Jahr 1949 Mitglieder sind.
In einer Rede am 7. April 2025 verdeutlichte Trumps Wirtschaftsberater Stephen Miran, worum es bei dem Kampf für MAGA geht. Die USA stellen zwei globale öffentliche Güter bereit: einen vom US-Militär überwachten Sicherheitsschirm und den Dollar, um den sich das internationale Finanzsystem dreht und dessen Kern US-Staatsanleihen bilden. Beides ist für die USA kostspielig, und der Präsident wollte klarstellen, dass die USA nicht länger bereit sind, für die Trittbrettfahrer anderer Nationen zu bezahlen (Erklärung des Weißen Hauses, 7. April 2025). Der sicherheitspolitische Aspekt kam in der Behauptung zum Ausdruck, dass die europäischen NATO-Mitglieder ihren gerechten Anteil an den Verteidigungskosten nicht zahlen, der laut Trump fünf Prozent des BIP beträgt. Er drückt sich manchmal so aus, als beziehe sich dies auf die Beiträge der NATO-Mitglieder zum NATO-Haushalt, während sich die Zahl tatsächlich auf ihre Verteidigungsausgaben als Anteil ihres BIP bezieht, wo ein Konsens von zwei Prozent besteht. Er machte deutlich, dass Mitglieder, die nicht genug zahlen, im Kriegsfall keine aktive Unterstützung der USA erwarten können. Mit seiner ostentativen Annäherung an Russland unter dem Deckmantel eines selbsternannten Vermittlers (im Ukraine-Krieg) hat Trump das Vertrauen in das Bündnis noch mehr untergraben als mit den Zweifeln, die er an Artikel 5 gesät hat. Trump hat das gesamte Bündnis ins Wanken gebracht. Die sicherheitspolitische Spaltung wird durch die handelspolitische Spaltung verschärft, die Trump durch groteske Zölle herbeiführt. Die Regeln gelten nicht mehr. Die regelbasierte internationale Politik auf der Grundlage des Völkerrechts und des Handelsrechts weicht der Willkür der Machtpolitik. Die neuen Zölle sind ein demonstrativer Bruch mit der neoliberalen Weltordnung, die seit den 1980er Jahren aufgebaut wurde und auf den Ideen des freien Welthandels basiert mit Produktion dort, wo es in globalen Lieferketten am billigsten ist, wo Zeitpräzision teure Lagerhaltung ersetzt und wo Löhne und Sozialstandards nach unten gedrückt werden.
Zum ersten Mal seit den 1930er Jahren kehrt Protektionismus als Programm zurück, und die Argumente der Trump-Regierung erinnern an Merkantilismus. In seiner Rede vom 7. April machte Präsident Trumps Berater Miran deutlich, worum es bei den Zöllen geht: andere Länder zu Tributzahlungen zu zwingen, um das amerikanische Imperium aufrechtzuerhalten. Die finanziellen Verpflichtungen zwingen die USA, hart arbeitende Amerikaner unfair zu besteuern – eine Aussage, die darauf hindeutet, dass die Einnahmen aus den Zöllen Spielraum für Steuersenkungen schaffen. Aber es geht auch darum, Industrieunternehmen zu zwingen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. Der Dollar als Weltwährung hat zu Wechselkursverzerrungen geführt, die wiederum unfaire Handelsbarrieren und langfristig untragbare Handelsüberschüsse gegenüber den USA geschaffen haben. Das Argument gilt für den Warenhandel, während die großen US-Handelsüberschüsse im Dienstleistungsbereich, die durch die digitalen Technologiegiganten geschaffen wurden, ignoriert werden.
Beide Problemfelder, Sicherheits- und Handelspolitik, werden durch ein unverhohlenes Bild Europas polarisiert, das die Trump-Regierung zeichnet, in dem die Europäer als Trittbrettfahrer und Parasiten der USA dargestellt werden. Sie sind Freifahrer. China wird derselben Karikatur unterworfen, aber die Emotionen scheinen stärker zu sein, wenn es um Europa geht. Die europäische Integration, die in der EU gipfelte, sei geschaffen worden, um den USA zu schaden. Der Präsident liefert keine Beweise für diese These. In der NATO leisten die Europäer keinen angemessenen finanziellen Beitrag, und im Handel beuten sie die USA unfair aus. Europa erscheint nicht nur als Karikatur, sondern auch als offener Feind.
Die Schlussfolgerung ist klar: Der Westen, wie er nach 1945 entstanden ist, existiert nicht mehr. Das Trump-Regime entwickelt ein Feindbild, in dem die Ursache allen Übels in Europa liegt. In einem Essay entwickelt Fintan O’Toole seine Gedanken zu Trumps Europhobie (O’Toole 2025). Obwohl Trumps Wahrnehmung der Realität instabil ist und sich ständig ändert, hat er feste Vorstellungen und unveränderliche Instinkte. Es sind diese Obsessionen und Instinkte, die derzeit die Beziehungen zwischen den USA und Europa dramatischer umgestalten als jemals zuvor seit 1945. Trump wendet sich nicht von Europa ab, er trampelt auf ihm herum. Sein Regime hat das Interesse an Europa nicht verloren. Es hat ein bösartiges Interesse daran entwickelt, die EU zu zerstören, schreibt O’Toole. Trumps Feindseligkeit gegenüber der EU zeigte sich erstmals in seiner begeisterten Unterstützung für den Brexit. Während seiner ersten Präsidentschaft kam seine Überzeugung, dass die EU ein ”Feind” auf Augenhöhe mit China sei, immer wieder zum Vorschein, blieb aber größtenteils latent. Jetzt geht es nicht mehr darum, Europa seinem Schicksal zu überlassen, sondern die EU von innen heraus zu untergraben und umzugestalten, indem man rechtspopulistische und extremistische Parteien offen unterstützt, wie Musk, Vance, Rubio und andere zum Ausdruck gebracht haben. Die EU kann nicht mehr davon ausgehen, dass die USA ihr wohlgesonnen sind, sondern muss davon ausgehen, dass sich in Abstimmung oder Zusammenarbeit mit Russland aktive Feindseligkeiten entwickeln könnten.
Das große Problem ist, dass die Trump-Regierung nicht nur in bestimmte Politikbereiche eingreift, sondern das gesamte Normensystem angreift, das Konzepte wie territoriale Integrität und nationale Souveränität umgibt. Trump folgt Putin. Dies hat konkrete Folgen, insbesondere in den internationalen Beziehungen, wo es keinen Leviathan gibt, keine Schutzmacht, die Normen und Regeln mit Polizei und Militär verteidigt. Trump greift die Norm der Forschungsfreiheit an und erteilt bedrohten Universitäten detaillierte Anweisungen. Er zeigt Verachtung für wissenschaftliche Erkenntnisse.
Die Sprache, die in der ersten Amtszeit mit Fake News und falscher Wahrheit oder alternativer Wahrheit begann, entfernt sich immer schneller von dem, was früher als Grundlage der Vernunft galt. Die wissenschaftliche Suche nach objektivem Wissen – verbunden mit der Erkenntnis, dass das Objektive aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann und dass ideologische Vorurteile die Suche trüben können – wird untergraben und Hexenjagden werden wiederbelebt. Kants kritische Vernunft als akademisches Handlungsprinzip wird abgelehnt. Die Absicht ist möglicherweise, eine Grundlage zu schaffen, um die Ideen des Philosophen durch KI zu ersetzen, die von Tech-Giganten produziert wird.
Die Sprache wird nicht nur im Orwellschen Sinne radikalisiert, wo Krieg Frieden und Frieden Krieg genannt wird, sondern auch dadurch, dass sie polarisierter und emotionalisierter wird. Einwanderung wird als Invasion bezeichnet. Auswanderung wird zu Remigration und Deportation. Es ist anzumerken, dass diese sprachliche Entwicklung in Europa dieselbe ist, wo die Einwanderungsfrage auf beiden Seiten des Atlantiks zu einem Katalysator, zu einem Stellvertreterproblem für eine Reihe anderer sozialer Probleme wird, die sich kurz in zwei Punkten zusammenfassen lassen: sozioökonomische Probleme im Zuge der Verwüstungen des Neoliberalismus und seines Zusammenbruchs in der Spekulationsblase von 2008 sowie der Klimawandel. Die Sprache wird immer exzessiver. Uns fehlt eine Sprache, die die neue Welt als das beschreibt, was sie ist: eine Abweichung von der Demokratie, die bisher der Standard war. Ihre Konzepte verwenden den demokratischen Standard, passen aber nicht mehr (Stråth & Trüper 2025). Europa klammert sich an die Ideale, an die es geglaubt hat, und verwendet weiterhin die Ausdrücke, die diese Ideale geprägt haben, anstatt den Wandel zu beschreiben. Europa möchte glauben, dass es sich noch immer in der Blütezeit der Demokratie befindet, als diese als selbstverständlich galt. Europa sieht sich als Gegenpol zum Fanatismus und Führerkult, der die USA beherrscht und von mächtigen Interessen in Verbindung mit Algorithmen angetrieben wird. Für Europa ist es existenziell, die Risiken für die Demokratie zu erkennen, die die digitale Revolution auch in Europa mit sich gebracht hat, und eine Sprache zu schaffen, die diese Risiken beschreibt. Welche Art von Öffentlichkeit bilden soziale Medien im Vergleich zu den Öffentlichkeiten, die die Demokratien in den 1950er und 1960er Jahren gestützt haben? Die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat, die Thomas Hobbes vor fast 400 Jahren den Herrschenden als Mittel zur Beendigung jahrzehntelanger Religionskriege in Europa vorgeschlagen hat, bricht zusammen, da das Private in den sozialen Medien öffentlich wird. Dieser freiwillige Verzicht auf Privatsphäre verändert die Bedingungen für Gesellschaftskritik und staatliche Kontrolle. Die brodelnden Emotionen und die Vereinfachungen, die komplexe Werte zerstören, infantilisieren und brutalisieren die öffentliche Debatte. Für Europa ist es existenziell, die Kontrolle über Algorithmen zu übernehmen und sie zu regulieren, um die Demokratie zu retten. Und zwar schnell.
Obwohl der Konflikt zwischen den USA und Europa das Hauptproblem ist, darf man nicht vergessen, dass Europa in der Entwicklung, die so viel Unruhe verursacht, nämlich der Emotionalisierung und Infantilisierung der öffentlichen Debatte, gefährlich nahe an den USA ist. Man sollte die Unterschiede zwischen den USA und Europa hinsichtlich der Intensität der sozialen Medien nicht überbewerten. Man könnte von einem nahen europäischen Wendepunkt sprechen, an dem sich alles in Richtung USA bewegt. Europa möchte eine Bastion der Werte sein, ist es aber nicht. Auf dieser Erkenntnis sollten wir aufbauen.
Eine Weltordnung in Auflösung. Was nun?
Anzeichen für ein anderes Amerika zeigten sich bereits während des Irakkriegs, und mit der Wahl Trumps zum Präsidenten im Jahr 2016 kam es zu einer Trendwende, die die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht sehen wollten. Stattdessen hofften sie, dass sein Mandat nur vorübergehend sein würde und er während seiner Amtszeit offen für den Dialog sein würde. Mit der Wahl Bidens im Jahr 2020 sahen sie Trump als historische Fußnote. Heute wissen wir, dass Biden die Parenthese war. In der europäischen Debatte im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Herbst 2024 gaben alle vor, sich auf Trumps Comeback vorzubereiten, aber die Vorbereitung bestand eher darin, sich ohne genauere Analyse davon zu überzeugen, dass Trump derselbe wie beim letzten Mal sein würde und dass die Lösung darin liege, ihm mit Schmeicheleien einen Deal abzuringen. Im Herbst verlagerten sich die Vorbereitungen auf Trump eher in Richtung Hoffnungen auf Harris. Niemand in der Planung hatte sich den zurückgekehrten Trump vorstellen können, am wenigsten seine Handlungen in der Ukraine-Frage. Alle wurden von seiner Entschlossenheit überrascht, die von den Tech-Oligarchen mit oder ohne Kettensägen unterstützt wurde.
Mit intellektueller Autorität beschrieb Jürgen Habermas den Bruch in einem Zeitungsartikel im März 2025 (Habermas 2025) mit starken Worten. Er spricht von einem epochalen Bruch, der tiefgreifende Folgen für Europa habe. Wenn die EU keine überzeugende Antwort finde, werde Europa in den Strudel der untergehenden Supermacht gerissen, argumentiert er. Denn es handele sich in der Tat um eine Macht im Niedergang, nicht um eine im Aufstieg. Habermas verurteilt die Unfähigkeit oder das Desinteresse der europäischen Staats- und Regierungschefs, ihre unverständliche Kurzsichtigkeit in ihrer Einschätzung der USA als führende Macht. Das unerschütterliche Vertrauen des deutschen Bundeskanzlers Scholz in die Einheit des Westens unter Biden als Antwort auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs in die falsche Richtung geführt, anstatt darauf zu drängen, dass Europa in der Ukraine Verantwortung für die Verteidigung seiner Sicherheit und der europäischen Werte übernimmt. Dieses Versagen habe sich als katastrophal erwiesen, als Trump über die Köpfe der EU hinweg Verhandlungen mit Putin aufnahm, die nur zuschauen konnte, argumentiert Habermas. Mit Trump 2 sei die Frage nach dem Schicksal der Ukraine zu einer Frage der existenziellen Selbstverteidigung der EU geworden, in einer Situation, in der sie nicht auf den Schutz der USA zählen könne.
Scholz trägt sicherlich einen Teil der Verantwortung für die Fixierung Europas auf die USA nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, möglicherweise mehr als jeder andere. Zu seiner Verteidigung lässt sich jedoch sagen, dass die Verbindungen Deutschlands zum Westen seit Adenauer fest verankert waren und nach dem brutalen Ende der engen Beziehungen zu Russland unter dem Motto „Wandel durch Handel” im Februar 2022 noch stärker geworden waren. Diese Beziehungen hatte Willy Brandt Anfang der 1970er Jahre in einer völlig anderen historischen Situation unter dem Motto „Wandel durch Annäherung“ geknüpft. Als dieses Motto nach 1990 eine neoliberale Formulierung erhielt, entstand die verhängnisvolle Vorstellung, der Markt würde die Ordnung automatisch steuern. Als Finanzminister in der großen Koalition mit Angela Merkel verlor Scholz den Bezug zu Brandts Ideen, aber damit stand er keineswegs allein da. In Deutschland war das Vertrauen in die USA ebenso unerschütterlich wie in Russland vor Februar 2022, nachdem man Trump 1 mit einem Seufzer der Erleichterung als Ausrutscher abtun konnte. Schließlich zeigen die finnischen und schwedischen NATO-Beitrittsgesuche nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass Scholz’ Deutschland mit seinem Vertrauen in die USA nicht allein stand.
Wenn Scholz nun der offensichtlichste Kandidat für die Rolle des Chamberlain unserer Zeit ist, stellt sich die Frage, wer Churchill ist. Hier kommt niemand anderes als der ukrainische Präsident Selenskyj in Frage. Ohne auf die Ähnlichkeiten im Detail einzugehen, lässt sich ein entscheidender Unterschied feststellen. Churchill hatte die Unterstützung der USA und nach dem Sommer 1941 auch der Sowjetunion. Je länger der Krieg dauert, desto mehr scheint Selenskyj allein dastehen. Die Hilflosigkeit in Europa wächst, während Trump und Putin über die Ukraine verhandeln. Europa steht vor der Aufgabe, die Rolle der USA bei der Unterstützung der Ukraine zu übernehmen, aber in der sich abzeichnenden Dynamik scheint es keinen Platz für Europa zu geben. Die Schwierigkeiten sind groß, aber die Weigerung, dies anzuerkennen und die Konsequenzen zu ziehen, macht sie noch größer.
Die Unvorhersehbarkeit ist vor dem Hintergrund dessen, was Habermas als Trumps ”das bizarre Auftreten und die verwirrende Rede“ bei der Amtseinführungszeremonie im Januar 2025 mit ”der fantastischen Beschwörung eines nun anbrechenden goldenen Zeitalters“ beschreibt, total. Trumps narzisstische Affektiertheit vermittelte dem unvorbereiteten Fernsehzuschauer, der die Zeremonie verfolgte, den Eindruck einer ”klinischen Vorführung eines psychopathologischen Falls”, aber der tosende Applaus im Saal und ”die erwartungsvolle Zustimmung von Musk und den übrigen Größen aus Silicon Valley” ließen keinen Zweifel an der Entschlossenheit von Trumps innerem Kreis. Der Fahrplan trägt die Handschrift der Heritage Foundation und ist seit langem bekannt (Heritage Foundation 2024). Es geht um eine institutionelle Umgestaltung des Staates. Die europäischen Beispiele in diesem Sinne, an denen Persönlichkeiten wie Orbán und das Kaczynski-Regime beteiligt sind, beschränken sich auf staatliche Eingriffe in das Rechtssystem und die Medien. Die Umgestaltung in den USA ist wesentlich radikaler. Der mit einer Kettensäge bewaffnete Säuberungskommissar Musk hat weitreichendere Ziele als nur den Abbau der staatlichen Verwaltung. Langfristig geht es darum, den Staatsapparat und seine Regelungen durch eine digital gesteuerte Technokratie zu ersetzen, argumentiert Habermas. Die Politik im Rahmen des historischen Staates soll durch eine digital gesteuerte Unternehmensführung mit einer stark verschlankten Staatsverwaltung ersetzt werden (Habermas 2025). Die Pläne der Techno-Oligarchen, die Regierung in einen Unternehmensvorstand umzuwandeln, hätten, wenn sie umgesetzt würden, schwer vorhersehbare Folgen.
Für Habermas ist nicht ganz klar, wie diese expansiven Ideen mit Trumps Handlungsstil, ”einer von geltenden Normen entbundenen Politik der überraschenden Willkürentscheidungen,” in Einklang zu bringen sind. Die obszöne Fantasie des Dealers und Immobilienmaklers, den leeren Gazastreifen wieder aufzubauen, deutet auf die Irrationalität einer bewusst unberechenbaren Person hin, die mit den religiös motivierten langfristigen Plänen des Vizepräsidenten für eine rechtspopulistische oder autokratische Definition von Demokratie kollidieren könnte, in der vollständige digitale Freiheit für Tech-Giganten das Leitprinzip ist. Habermas merkt an, dass die autoritäre Form der Digitalisierung wenig mit dem historischen Faschismus zu tun hat. Einmal zerstörte Institutionen lassen sich nicht ohne Weiteres wiederherstellen. Habermas’ Schlussfolgerung kann man hinzufügen, dass die Paladine, Speichellecker und Hofnarren, die das unmittelbare Umfeld des amerikanischen Präsidenten bilden, keineswegs neu sind. Die Geschichte liefert viele Beispiele dafür. Neu ist ihre technologische Macht, die Fragen darüber aufwirft, wer wirklich die Kontrolle hat.
Unberechenbarkeit als politisches Machtinstrument bedeutet nicht, dass Trump keinen Plan oder kein Ziel hat. Man muss davon ausgehen, dass er es ernst meint und einen Plan hat, Amerika wieder groß und stark zu machen, auch wenn überraschend wenig darüber diskutiert wird, wie ein solcher Plan aussehen könnte. Es ist schwierig, in einem sprunghaften Vorgehen, bei dem Ziele festgelegt und ebenso schnell wieder zurückgenommen werden, langfristiges Denken zu erkennen: Frieden in der Ukraine, Zölle zum Schutz der USA vor ausländischer Ausbeutung usw. Er ruft zum Angriff auf und verspricht Großes und Durchbrüche, aber wenn er auf starken Widerstand stößt, wird der Angriff gestoppt und neue Energie in ein neues Ziel investiert, und so weiter. Der Wechsel von der ”Friedensvermittlung” in der Ukraine zur ungebremsten Zollkampagne und dann zurück zur Ukraine folgt einem Muster.
Trump will die Institutionen, Regeln und Kooperationsmuster der bestehenden Weltordnung zerstören. Er will eine (Un-)Ordnung schaffen, in der die Starken herrschen. Kleine Staaten spielen keine Rolle. Eine Handvoll Supermächte entscheiden unter sich über das Schicksal der Welt. Ihre Vereinbarungen sind oft ungeschrieben, geheim und/oder implizit und nicht unbedingt von langer Dauer.
Es ist ein Mythos, dass der Imperialismus mit der Entkolonialisierung nach 1945 verschwunden ist. Während des Kalten Krieges setzte er sich in der Dritten Welt als Stellvertreterkriege zwischen Supermächten und Wettbewerb mit konventionellen Waffen fort (Westad 2005; Stråth & Trüper 2025). Aber überraschenderweise ist er heute so stark wie nie zuvor.
Wenn man von oben auf einen Globus schaut und der kanadischen Landmasse vom Labradorkanal nach Westen folgt, gelangt man nach Alaska und über die Beringstraße nach Sibirien und schließlich nach Murmansk. Von dort ist es nur noch ein kurzer Schritt nach Grönland. In die andere Richtung, von Labrador nach Osten, erreicht man schnell Grönland und von dort aus Murmansk von der anderen Seite. Die USA und Russland würden den Globus unter dem Nordpol umfassen, wenn Grönland und Kanada zu den USA gehören würden, und sie würden sowohl die Nordwest- als auch die Nordostpassage kontrollieren. Außerdem hätten sie Zugriff auf unbekannte Mengen seltener Mineralien. Es sei betont, dass dies hypothetische Überlegungen sind, und wenn sie sich als wahr herausstellen sollten, ist es eine Sache, was Trump will, und eine andere, was er erreichen kann. Aber man muss davon ausgehen, dass Trump einen Plan und eine Weltanschauung hat.
Putins Russland wird wahrscheinlich nicht wie reife Früchte auf Trumps Einladungen hereinfallen und muss auch seine Beziehungen zu China berücksichtigen. Die imperialistischen Beziehungen zwischen den Supermächten sind nicht unbedingt harmonisch. Sie sind machtorientiert und opportunistisch, eher wechselhaft als dauerhafte Freundschaften. Vor dem Hintergrund dieser hypothetischen, aber nicht unrealistischen Überlegungen fällt auf, wie isoliert und unbedeutend Europa im Spiel um den Frieden in der Ukraine und die Annäherung zwischen den USA und Russland erscheint.
Man kann nur zu dem Schluss kommen: Wenn Frieden bedeutet, dass Putin das erobert behält, was Russland erobert hat, und Trump eine zerrissene und kriegsmüde Ukraine dazu zwingt, der amerikanischen Ausbeutung der Bodenschätze in den Überresten der Ukraine zuzustimmen, dann ja, dann werden amerikanische Grabungen und Bohrungen die Integrität des restlichen Ukraine vor russischer Aggression garantieren. Zu welchem Preis, könnte man fragen, aber europäische Friedenstruppen werden nicht benötigt.
In einem kurzen Artikel sieht Nils Gilman eine Öl- und Gas-Koalition gegen erneuerbare Energien zwischen den USA und Russland entstehen, die sich auf die anhaltende Luftverschmutzung stützt (Gilman 2025). In diesem Zusammenhang ist das erklärte Interesse sowohl Russlands als auch der USA am Nahen Osten bemerkenswert. Eine solche Koalition, die die Arktis mit der Nordwest- und Nordostpassage kontrolliert, dürfte einen Konflikt mit China kaum vermeiden können, das sich mehr als jede andere Macht als Verfechter grüner Energie profiliert hat. Die USA und Russland können China nicht außer Acht lassen und tun dies auch nicht, sondern suchen eine Einigung mit dem einstigen Reich der Mitte, das diesen Namen nun offenbar zurückerobern will. Anstelle eines Triumvirats könnte sich ein Dreiecksdrama abzeichnen. Wo steht die EU in einer solchen Situation? Indien? Ist die Idee, falls es eine gibt, Trump zu beschwichtigen, oder sollte die EU hoffen, dass alles gut geht? Wie die Maus, die geschockt die Schlange anstarrt und euphemistisch versucht, ihre Lähmung mit der Behauptung zu verbergen, sie habe einen kühlen Kopf und wartet ab.
Wie konnte es dazu kommen? Zwei amerikanische Interpretationen
Eine Flut von Literatur versucht, die Entwicklungen in den USA zu verstehen und zu interpretieren. Zwei Bücher sollen hier als bei weitem nicht erschöpfende Beispiele für mögliche Interpretationen hervorgehoben werden.
Robert Kagan, der die USA mit dem Mars und Europa mit der Venus verglich (Kagan 2003), hat seine neokonservativen Überzeugungen aus der Zeit des Irakkriegs aufgegeben und reflektiert in einem neuen Buch, wie die Entwicklungen in den USA so kommen konnten (Kagan 2024). Sein Ausgangspunkt ist, dass die US-Verfassung von 1787 von Anfang an fehlerhaft war. Sie proklamierte die Gleichheit und die Rechte aller Menschen, aber ihre Verfasser waren sich bewusst, dass schwarze Sklaven davon ausgenommen waren. Washington und Jefferson besaßen beide Sklaven. Die Gründerväter trösteten sich mit der Hoffnung, dass irgendwann im Laufe der Entwicklung des amerikanischen Volkes die Vernunft siegen und eine Einigung über die Abschaffung der Sklaverei erzielt werden würde. In den 1830er Jahren kam es zu Spannungen, als neue Staaten in die Union aufgenommen werden sollten und deren Status in der Sklavenfrage geklärt werden musste. Diese Spannungen lösten den Bürgerkrieg 1861–65 aus. Der Konflikt drehte sich nicht nur um die Sklaverei, sondern auch um die Spaltung zwischen Stadt und Land und unterschiedliche Industrialisierungsgrade, wobei illiberale Kräfte die liberale Verfassung immer wieder in Frage stellten.
Nach dem Bürgerkrieg verstärkten sich die Einwanderung und die Industrialisierung, und es entstanden neue Spannungen zwischen neuen ethnischen Gruppen: Angelsachsen/Nordeuropäer gegen Südeuropäer gegen Osteuropäer gegen Chinesen gegen Japaner. Das Chinese Exclusion Act von 1882 und das Immigration Act von 1924 waren Ausdruck dieser Spannungen. Der Schmelztiegel war alles andere als harmonisch. Die Rassendebatte verschärfte sich. Die 1920er Jahre waren die Ära des Jazz, aber auch des Ku-Klux-Klans, und während der Krise der 1930er Jahre zeigten sich illiberale Tendenzen. Universalistische, kosmopolitische, internationalistische, progressive und aufgeklärte liberale Strömungen waren immer präsent, wurden aber ständig herausgefordert, auch wenn die 1930er bis 1950er Jahre grundsätzlich liberale Jahrzehnte waren. Aber es gab auch den Ku-Klux-Klan, McCarthy und die Rassenfrage mit den Busing-Maßnahmen, Little Rock und Martin Luther King. Und John F. Kennedy, der die Nationalgarde einsetzte, um die Rassendiskriminierung an Universitäten zu stoppen. Es war, als hätte sich die amerikanische Gesellschaft nie beruhigt, sondern wäre ständig herausgefordert worden. Der 11. September passt gut in dieses Muster der Unruhe. Wie bereits erwähnt, hatte Huntington bereits 1996 (Huntington 1996) über die Konfrontation der Zivilisationen als Herausforderung der Zukunft geschrieben. Dies betraf vor allem die christliche und die muslimische Zivilisationen, die 2001 in Form von religiösem Fanatismus, Terrorismus und Krieg zum Ausbruch kommen sollten. Huntington äußerte jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Zusammensetzung der amerikanischen Bevölkerung. 1965 machten Weiße europäischer Abstammung 84 Prozent der US-Bevölkerung aus. Hispanics machten weniger als vier Prozent und Asiaten weniger als ein Prozent aus. Zu Beginn der 2000er Jahre war der Anteil der Weißen europäischer Abstammung auf 62 Prozent gesunken, mit einer rückläufigen Tendenz, während Hispanics 18 Prozent und Asiaten sechs Prozent ausmachten, mit einer steigenden Tendenz. Huntington (2004) äußerte sich besorgt über die anglo-protestantische Kultur, die ihren politischen Ausdruck in der Verfassung von 1787 gefunden hatte.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die liberale Bewegung der Aufklärung immer präsent war. George W. Bush war ein echter Multikulturalist und Kosmopolit. Aber er wurde ständig von antiliberalen Fundamentalisten, religiösen Fanatikern und Kulturkriegern herausgefordert. In wichtigen Punkten wurde der Konflikt um die soziale Verteilung von der Kulturdebatte überschattet, und diese Überschattung ist zu einem Problem geworden, das Trump erfolgreich für sich genutzt hat. Nach Kagans Ansicht kommt die lange antiliberale Tradition in Trumps Bewegung zum Ausdruck. Kagan sieht Trump als Teil einer langen Reihe von Vertretern der antiliberalen Kontinuität in den USA. Kagan zögert nicht, Trump als Führungstyp direkt mit Hitler zu vergleichen: charismatisch, mit Emotionen spielend und Angst, Terror und Unsicherheit schürend. Trump schafft Gehorsam durch Angst statt Loyalität durch Vertrauen. Die Frage, die Kagan nicht vertieft, ist, ob wir weiterhin auf ein Comeback der ebenso langen liberalen Kontinuität seit der Gründung des Landes zählen können, wobei beide Kontinuitäten sich ständig gegenseitig herausfordern.
Die Politikwissenschaftler Stephen Hanson und Jeffrey Kopstein betrachten die Entwicklungen in den USA aus einer breiteren internationalen Perspektive. Sie erkennen ein Muster, das sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet hat und das sie mit dem verbinden, was Max Weber in seiner Herrschaftstypologie als Paternalismus bezeichnet hat (Hansson & Kopstein 2024, Weber 1980 [1922]: 122–176). Willkürliche Herrschaft durch Führer, die sich als Vater der Nation stilisieren und in einer als unsicher und im Niedergang begriffen empfundenen Zeit Größe und Sicherheit versprechen. Sie umgeben sich mit einem Hofstaat aus Familienmitgliedern, Günstlingen und Hass-Experten in Regierungsverwaltungen und internationalen Organisationen. Die Herrscher und ihre engen Vertrauten zögern nicht, sich auf Kosten der Öffentlichkeit zu bereichern. Korruption ist ein wichtiger Teil des Systems, ein Schmiermittel. Historische Beispiele in Hansons und Kopsteins Skizze sind die russischen Zaren. Wenn nötig, griffen sie zu Zwangsmaßnahmen und mobilisierten die Unterstützung der wirtschaftlichen Eliten und Intellektuellen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie Rechtsstaatlichkeit und Rechtsprinzipien verletzen und Willkür in das System einführen. Begriffe wie Autokratie, Diktatur, Autoritarismus und Populismus fangen das Phänomen ein, decken aber nicht seine Gesamtheit und Komplexität ab. In Europa denkt man dabei an Putin und Orbán, in den USA natürlich an Trump. Aber es gibt noch viele andere Namen, wie Johnson, Bolsonaro, Erdogan, Milei und Modi, die sich alle voneinander unterscheiden und ihre eigenen Profile haben. Das Phänomen ist global. Trump ist daher kein Einzelfall, sondern folgt einem sich abzeichnenden Muster, auch wenn er der auffälligste und derjenige zu sein scheint, der mehr als die meisten anderen in seinem Umfeld die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sucht.
Diese Entwicklung ist ein umfassender globaler Angriff auf den modernen, auf Regeln basierenden Staat, den Niedergang der Demokratie und den Übergang zur persönlichen Herrschaft. Hansson und Kopsstein sehen Putin als vielleicht wichtigstes Bindeglied in dieser Transformation und zögern nicht, ihn als Trumps Inspirationsquelle zu bezeichnen. Gleichzeitig betonen sie, dass Putins Erfolg als Leitfigur darauf zurückzuführen ist, dass der Boden gut vorbereitet war. Die neoliberale Ideologie verwandelte viele soziale Liberale in Libertäre. Sie beschrieb den Staatsapparat als erstickende Zwangsjacke, die sich aus der Wirtschaft heraushalten sollte, außer um die Marktfreiheit zu garantieren. Die Botschaft war kraftvoll und erfolgreich. Hansson und Kopstein sehen den Auslöser für die paternalistische Entwicklung im Zusammenbruch der Finanzmärkte 2008, doch im Falle Russlands gab es einen Vorlauf: die Horden westlicher Berater, die in das zerfallende Sowjetimperium strömten und den Insolvenzverwaltern sagten, was sie zu tun hätten. Das verknöcherte Staatseigentum müsse privatisiert werden, was die gesamte Wirtschaft wiederbeleben würde. Demokratie würde Zeit brauchen, aber sie würde automatisch auf eine boomende Wirtschaft folgen. Der vom Westen initiierte und geförderte interne Ausverkauf des bankrotten Staatsvermögens schürte Putins Verbitterung, und er sah den Zusammenbruch des Sowjetimperiums zunehmend als historische Katastrophe. Letztendlich wurde es sein Ziel, diesen wiederherzustellen. Nicht die NATO als externe Bedrohung, sondern der innere Zerfall dessen, was als blühende Landschaft versprochen worden war, veranlasste Putin zum Handeln und dazu, die fragile Demokratie aufzugeben, die die Diktatur ersetzen sollte. Die Jahre 2006 bis 2008 brachten einen Kurswechsel mit sich, dessen Meilensteine die westlichen Ambitionen Georgiens – wo Putin natürlich die NATO als Bedrohung sah – und die Rede in München waren. Der Zusammenbruch der Finanzmärkte im Jahr 2008 bestätigte die Ansicht des russischen Herrschers, dass der kapitalistische Westen dekadent und verrottet war und dass die Kehrtwende richtig war.
Der dunkle Hintergrund der Bühne, der Schauspieler und die Produzenten des Dramas
In Cue the Sun! – The Invention of Reality TV beschreibt Emily Nussbaum (2024), wie der Schauspieler Donald Trump sich selbst in einer Fernsehserie als reichere und erfolgreichere Version des halb gescheiterten Immobilienmaklers spielte, an dem die Banken zu zweifeln begonnen hatten. Er inszenierte sich als den superreichen Tycoon, für den ihn Millionen von Amerikanern, die die Serie verfolgten, später hielten. Er spielte eine karikaturistische Version seiner selbst, und das Publikum hielt die Karikatur für die Realität. Auch der Schauspieler selbst hielt die Karikatur für sein wahres Ich. Das funktionierte so gut, schreibt Nussbaum, weil Trump eine Eigenschaft besonders gut beherrschte: die Kunst, unerwartete Wendungen in der Handlung zu schaffen. In dieser Hinsicht verhielt sich Trump oft so impulsiv und wich so stark vom Drehbuch ab, dass er die verantwortlichen Redakteure zur Verzweiflung trieb. Sie mussten Episoden neu schneiden oder sogar ganze Dialoge nachträglich mit einer veränderten Begleitkommentare versehen. Doch so frustriert die Produzenten auch waren, sie bemerkten auch, dass Trumps unberechenbare Impulse, seine plötzlichen Wendungen und überraschenden Launen das Publikum unter dem Motto ”In Trumps Welt ist immer etwas los“ in Atem hielten. So muss man sich auch den echten Präsidenten Trump vorstellen, wenn er den Präsidenten Trump spielt.
In Wirklichkeit stehen auch seine Drehbuchautoren und Redakteure im Hintergrund und sind ständig bereit, Abweichungen vom Drehbuch zu korrigieren. Es wäre ein großer Fehler, seinen Beraterstab und diejenigen, die das Drehbuch schreiben und das Drama produzieren, zu ignorieren. Trump ist sicherlich keine Marionette, aber er hat das Drama nicht selbst geschrieben.
Zu den Produzenten gehört der Vizepräsident, der tief gläubige J. D. Vance, der 2019 zum Katholizismus konvertierte und selbstbewusster und unabhängiger wirkt als jeder Vizepräsident vor ihm. Und ideologischer. Der Katholizismus, der ihn antreibt, ist nicht der Mainstream, sondern eine erzkonservative Bewegung, die im Geiste de Maistres, dem Gegenaufklärer, der die Romantik einläutete, Gegenrevolution versprüht. Für Vance ist Politik weniger ein Wettstreit um die Mehrheit als ein existenzieller Kampf zwischen Gut und Böse.
In seinen Memoiren Hillbilly Elegy (2016) erzählt J.D. Vance von seiner Kindheit mit einer drogenabhängigen Mutter in den Kohlebergwerken der Appalachen, wo er sich minderwertig fühlte, weil das amerikanische Establishment auf sie herabblickte. Aus diesen Gefühlen entstand ein Bedürfnis nach Selbstbehauptung. In seiner Geschichte schreibt er, dass nicht er radikalisiert wurde, sondern die Linke. Sie habe die Universitäten zu einer intellektuellen Monokultur gemacht. Sie habe die USA zu einer Fassade der Demokratie unter einem Staat gemacht, der von einer Expertenbürokratie geführt wird, dem Deep State, wie Vance das Regime nennt, das der Ideologe der Bewegung, Curtis Yarvin, als Kathedrale und Peter Thiel, der Philosoph unter den Tech-Milliardären, als Ministerium für Wahrheit bezeichnet. Sie alle forderten eine Revolution von oben unter dem Slogan RAGE, Retire All Government Employees (Alle Regierungsangestellten in den Ruhestand schicken). Yarvin, geboren 1973, Blogger und Softwareentwickler, war bereits Anfang der 2000er Jahre zusammen mit Nick Lane die vielleicht prominenteste Figur in einer antidemokratischen und anti-egalitären Gemeinschaft, die eher eine digitale Community mit Slogans wie „Alternative Right“, „Alt-Right“, „Neo-Reaktionär“ und „Dark Enlightenment“ war als eine Bewegung (Lane 2022, Yarvin 2024). In ihren Medienauftritten waren sie zukunftsorientiert, aber sie schöpften ihre Zukunftsvisionen auf eigentümliche Weise aus der Vergangenheit. Curtis Yarvin ließ sich von Thomas Carlyle inspirieren, dem Sozialidealisten des 19. Jahrhunderts, der die Geschichte als Schöpfung von Helden sah. Sie befürworteten eine Rückkehr zur Monarchie in neuen Formen, in denen ein Unternehmen den Staat unter verantwortungsvoller monarchischer Unternehmensführung ersetzte. Der Hauptfeind war alles, was mit Demokratie, liberalen Ideen, Aufklärung und der Idee des Fortschritts zu tun hatte. Was mit Trump 2 plötzlich zur politischen Realität geworden ist und alle schockiert und überrascht, hat sich in einem langen Prozess der Gärung unter der Oberfläche der Demokratie entwickelt, die die öffentliche Debatte im Westen als selbstverständlich hingenommen hat. Unter Trump 1 brodelte die Gärung etwas, verschwand aber unter Biden wieder. Wenn die Sprecher der neuen Ordnung von neoreaktionärer Politik sprachen, meinten sie nicht den Konservatismus ihrer Großväter oder Edmund Burke, sondern die Verbindung moderner technischer Prinzipien mit klassischen antidemokratischen Ideen im Internetzeitalter 2.0. Die Aufklärung und die darauf folgende Idee des Fortschritts waren ein Fehler. Der demokratische Liberalismus, der auf den Idealen von Freiheit und Gleichheit basiert, muss mit darwinistischen Augen betrachtet werden.
Vance knüpft an solche Ideen an, wenn er mit Steve Bannon, Trumps Berater während seiner ersten Amtszeit, zusammenarbeitet, um eine internationale rechtsnationalistische Bewegung aufzubauen. Sie wollen die Rechtspopulisten und Extremisten Europas zu einem Instrument von MAGA machen, zu einem subversiven Instrument mit einem antiliberalen, autoritären und paternalistischen Programm, um die Macht des Volkes neu zu definieren und die liberale Demokratie und ihre größte Errungenschaft, den Wohlfahrtsstaat, zu zerstören. Putin drückt sein Ziel nicht anders aus, zumal Trump die imperialistische Expansion auf die Agenda gesetzt hat. Es entstehen zwei sich überschneidende politische Programme, das amerikanische und das russische. Einerseits suchen sie den Konflikt mit Europa, um sie umzusetzen. Andererseits suchen sie Partner in Europa, die das gleiche Ziel verfolgen.
Donald Trumps Triebkraft und Ziel ist es, Amerika wieder groß zu machen. Er will dies durch die Wiederbelebung des Rust Belt erreichen. Der Fokus liegt auf der Fertigungsindustrie, insbesondere der Automobilindustrie. Zölle, deren Höhe scheinbar aus der Luft gegriffen ist, sollen Konkurrenten ausschließen und/oder sie zwingen, Fabriken in den USA zu errichten. Hinter diesem Ziel steht eine merkantilistische, statische Denkweise. Es gibt einen Widerspruch. Fabriken, die Autos und andere Produkte herstellen, schaffen nicht nur Arbeitsplätze, sondern importieren in der heutigen globalisierten Welt auch Komponenten, deren Kosten aufgrund von Zöllen in die Höhe schnellen. Und diese Kosten schlagen sich in höheren Preisen nieder. Es war kein Zufall, dass die US-Autoindustrie mit Entlassungen begann, als Trump die Zölle erhöhte. Die Größe, für die Trump arbeitet, liegt in der Vergangenheit. Wenn die tiefere Idee darin besteht, die bestehende Weltordnung und das politische System der USA zu zerstören, dann sind die Widersprüche zwischen Trump und den Oligarchen offensichtlich. Dies wird jedoch nicht zum Problem, im Gegenteil. Die Widersprüche und inneren Konflikte tragen zur allgemeinen Verwirrung bei und schaffen Chaos. Die Produzenten von Trumps Drama reiben sich vor Freude die Hände.
Die Zerstörung der europäischen Demokratie ist ein wichtiges Ziel in der Kampagne der Tech-Oligarchen für eine neue Weltordnung. Vizepräsident Vance, Peter Thiels Protegé, ist der eloquenteste Vertreter und Verbindungsmann der Tech-Oligarchen zu Trump. Seine Äußerung auf der Sicherheitskonferenz in München im Februar 2025 war kein Zufall. Als der deutsche Verfassungsschutz im Mai 2025 der Bundesregierung einen 1.100-seitigen Bericht übergab, in dem er zu dem Schluss kam, dass die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland verfassungsfeindlich und extremistisch ist, äußerte sich Vance ebenso bombastisch wie in München und behauptete, dass die Mauer, die die USA und Westdeutschland 1989 eingerissen hätten, nun von der deutschen Regierung allein wieder aufgebaut werde. Marco Rubio fügte hinzu, Deutschland sei eine Tyrannei. Der Vizepräsident und der Außenminister ignorierten die Tatsache, dass es sich um einen offiziellen Bericht handelte, der noch nicht politisch aufgearbeitet war, als sie wie Vance in München erklärten, ein demokratisches Deutschland müsse die AfD vollständig in die parlamentarische Debatte integrieren. Alles andere wäre undemokratisch. Vance propagiert den Mythos der wahren demokratischen Mehrheit, die auch Rechtsextreme umfasst, und der falschen Mehrheit, die in der Mitte geschaffen wird, und er tut dies am Beispiel Deutschlands.
Die Neudefinition des Demokratiebegriffs durch den Vizepräsidenten geht in Richtung der völkischen Bewegung der 1930er Jahre. Rechtspopulisten, heute Rechtsextreme in Deutschland, streben in die gleiche Richtung, wo Populismus und die Idee von Volksherrschaft in den Mythen der Vergangenheit vereint sind. Diese Sichtweise ist heute genauso gefährlich wie im Deutschland der 1930er Jahre. Vance setzt die Kampagne von Steve Bannon unter Trump 1 für eine autoritäre und paternalistische Internationale der rechten Nationalisten und Antiliberalen fort, mit einflussreicher Unterstützung von Elon Musk und Außenminister Rubio. Das Ziel ist die Zusammenarbeit in dieser Internationale mit den rechten Nationalisten Europas, die sich im EU-Parlament gebildet haben. Sie stehen für das, was das Trump-Regime als demokratische Zukunft Europas definiert. Sie werden den Technologieplattformen völlige Freiheit von Regulierung in Europa garantieren. Ihre große Hoffnung in Europa ist Georgia Meloni, die offenbar versucht, einen Balanceakt zwischen dem Demokratieverständnis der EU und der Verachtung der Technologieunternehmen für die Demokratie zu vollführen.
Trumps Politik steht in krassem Gegensatz zur Agenda der Technologieoligarchen in entscheidenden Fragen. Ihre Zukunft liegt nicht im Rust Belt und in den Ölfeldern. Sie träumen davon, den Mars zu kolonisieren, Raumfahrt zu betreiben und durch künstliche Intelligenz ewiges Leben zu erlangen (Peter Thiel). Sie sagen nichts über Beschäftigung, denken aber darüber nach, wie KI Arbeitsplätze ersetzen kann. Sie zeigen offen ihre Verachtung für den Deep State und seine Expertenherrschaft. Sie wollen ihn zerstören und durch ein vollständig digitalisiertes Unternehmen mit Tech-Oligarchen an der Spitze ersetzen. Die Überwachung durch den massiven Einsatz von KI wird wahrscheinlich Teil des Arsenals der Regierung sein. Trump scheint voll und ganz hinter der Agenda der Tech-Oligarchen zu stehen und manifestiert dies durch die Einstellung von Elon Musk für die Zerstörungsarbeit. Es ist jedoch unklar, ob er die Auswirkungen und den Umfang des Programms oder seine eigene Rolle darin versteht. Seine Erfahrung ist die eines Immobilienspekulanten und Fernsehschauspielers. Musks Entlassung als Chef-Staatszerstörer nach weniger als sechs Monaten zeigt auch, dass es Spannungen zwischen den Oligarchen und zwischen ihnen und Trump gibt. Als Autohersteller war Musk gegen die Zollpolitik.
Trump und die Tech-Oligarchen sind sich einig in ihren Bemühungen, die USA zu einer neuen globalen Steueroase zu machen und in der Offshore-Welt gesetzlose Zonen einzuführen, wie sie Slobodian in Crack-Up Capitalism (2023) beschreibt. Die Trump-Regierung fördert den Handel mit Kryptowährungen und unterstützt Online-Casinos und Wettplattformen. Mit Plänen für eine strategische Krypto-Reserve untergräbt Trump unbeabsichtigt den Dollar. Die treibende Kraft hinter Kryptowährungen ist der Wunsch, Geld durch Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu verstecken. All dies mit dem Ziel, die globale illegale Wirtschaft zu stärken. Die USA verlassen internationale Verhandlungen über Steuerkooperation und viele andere internationale Kooperationen. Joseph Stiglitz (2025) sieht einen einzigen Hoffnungsschimmer: Der Austritt der USA wird es dem Rest der Welt erleichtern, seine Arbeit an der internationalen Besteuerung multinationaler Unternehmen im Rahmen der G20, der UNO und der OECD ohne die USA fortzusetzen, die bisher das Haupthindernis für Fortschritte waren.
Parallel zu den Arbeiten an dieser gesetzlosen, digitalisierten Niedrigsteuergesellschaft, in der Chaos und das Gesetz des Dschungels ohne staatliche Eingriffe herrschen, versucht Trump, Ordnung zu schaffen, indem er die Industriegesellschaft wiederbelebt, deren Blütezeit in der Vergangenheit liegt. Wachstum wird dort jedoch nicht mehr generiert, sondern in der Produktion von Dienstleistungen, insbesondere Finanzdienstleistungen. Trump will alles unreguliert lassen, frei für persönliche Bereicherung ohne jeglichen Anspruch auf Autorität. Die Ordnung gilt für die Arbeiter im Rust Belt, die nach Sicherheit mit moralischer und wirtschaftlicher Anerkennung schreien. Sie sind es, die den Populismus als Quelle der Unzufriedenheit unterstützen. Ihnen zuliebe will er die industrielle Produktion zurück in die USA holen.
Seit 2008 stehen zwei Schlagworte auf der Tagesordnung: Sozial und Nation. Es war die Errungenschaft der liberalen Demokratie nach 1945, sie im Wohlfahrtsstaat zusammenzuführen. Im Kampf um eine Neudefinition, der jetzt im Gange ist, berufen sich die Herausforderer auf ein historisch bewährtes, viel radikaleres Modell des Nationalsozialismus. Das Experiment endete in einer gigantischen Katastrophe. Auf den Trümmern dieser Katastrophe wurden die demokratischen Wohlfahrtsstaaten aufgebaut. Alle Kräfte müssen mobilisiert werden, um zu verhindern, dass sie zu neuen Trümmern werden. Alle müssen erkennen, dass mächtige Kräfte daran arbeiten, genau das zu erreichen. Hier geht es um viel mehr als um ein paar Spin-Doktoren und Showboater. Es geht um die dunklen und tiefen Kräfte der Zerstörung, die vor dem Übergang in die KI-Welt die Apokalypse suchen, mit der Romantik der Konterrevolution als Ideologie und modernster digitaler Technologie als Waffe. Es geht nicht, wie die Männer der Finsternis behaupten, um den Deep State mit seinen Experten. Der ist nur ein Hindernis auf dem Weg.
Hinter den Ideologen und ihrem politischen Sprachrohr, Vizepräsident Vance, stehen die Tech-Oligarchen. Sie als reich zu bezeichnen, ist eine Untertreibung. Die führenden Denker sind die grauen Eminenzen, der Risikokapitalgeber Marc Andreessen und der rätselhafte, philosophisch gebildete Peter Thiel, ebenfalls Risikokapitalgeber (Chafkin 2022, Thiel 2014). Thiels Philosophie hat eine theologische Dimension, die er in Zusammenarbeit mit dem Religionsanthropologen René Girard entwickelt hat, der sein Mentor in den tiefgründigen Fragen des Kreuzes und der Auferstehung, der Offenbarung, der Apokalypse und der Transzendenz war. Disruption ist das Schlagwort. Grenzen zerstören und überwinden. Transzendenz bedeutet, dass KI den Menschen ersetzt und in ihrer Vollkommenheit ewiges Leben erreicht. Thiel glaubt nicht an liberalen Wettbewerb, sondern an illiberales Monopol. Er hat kein Problem mit zentralisierter Staatsmacht und Polizeigewalt. Move fast and break things, wie Mark Zuckerberg es ausdrückt. Hinter dieser neuen Glaubensgewissheit spürt man den Philosophen des Willens und der Übermenschlichkeit, Friedrich Nietzsche. Derselbe Nietzsche, der in seiner zyklischen Sicht der Zeit auch davor warnte, dass die Menschheit ihre Fehler immer wieder wiederholen würde, ohne aus ihnen zu lernen: “O Mensch, Gib acht“ (Nietzsche 1891), das Gustav Mahler in seiner Dritten Symphonie so ergreifend vertont hat. Nietzsche kann selektiv gelesen werden, um seine Ambivalenz zwischen dem Zyklischen und dem Transzendenten zu leugnen. Das Potenzial für den Untergang ist in beiden Versionen vorhanden, der triumphalen und der warnenden. Nietzsches Übermensch tritt deutlich zutage, wenn Peter Thiel KI als das Instrument sieht, das ewiges Leben ermöglicht. Aber die Tech-Oligarchen mit ihrem immensen Machtpotenzial sind nicht nur philosophische Träume davon, das Unmögliche möglich zu machen, sondern auch Elon Musk mit seiner Kettensäge und die bodenständigeren Zuckerberg, Bezos und viele andere. Sie als irrelevant für Trump abzutun, wäre ein großer Fehler. Sie sind es, die das Drehbuch schreiben und Trumps Drama inszenieren.
MAGA sollte nicht als kohärente Ideologie gesehen werden, sondern als ein Diskurs voller Widersprüche, in dem einige eine härtere Haltung gegenüber China wollen, während andere einen weicheren Ansatz bevorzugen. Europa ist nicht besonders relevant, außer als rechtspopulistisches und extremistisches Europa unter der digitalen Macht der USA.
Was nun, Europa?
Die geopolitische Lage hat sich grundlegend verändert. Oder besser gesagt: Die zerfallende Ordnung, die man den Westen nannte, hat sich in eine globale Geopolitik verwandelt. Für Europa ist die Front des Kalten Krieges zurück, mit dem entscheidenden Unterschied, dass Europa nicht mehr die USA hinter sich hat und dass Westeuropa zu einem Europa mit größerer sicherheitspolitischer Verantwortung, aber auch mit größeren inneren Spannungen geworden ist. Die imperiale Politik Russlands geht weiter als die sowjetrussische während des Kalten Krieges, als das nukleare Gleichgewicht eine gewisse Zurückhaltung bedeutete. Jetzt geht es um konventionelle Kriegsführung mit der drohenden Gefahr von Atomwaffen im Hintergrund. Es wird befürchtet, dass die baltischen Staaten, Georgien und Moldawien zu neuen Spielbällen in Putins Bestrebungen werden, die Grenzen des Sowjetimperiums wiederherzustellen. Natürlich über die Ukraine hinaus.
Diese Situation hat Habermas dazu veranlasst, in geopolitischen Kategorien zu denken, was für ihn Neuland ist und zeigt, wie dramatisch der Wandel ist. Er argumentiert, dass Europa als Reaktion auf die Lage seine Zusammenarbeit vertiefen muss, und wirft Olaf Scholz als Bundeskanzler Versäumnisse in dieser Hinsicht vor. Habermas bestreitet nicht die Argumente für eine militärische Aufrüstung, warnt aber vor dem Hintergrund der Stärke der AfD vor einer militarisierten Deutschland, und genau an dieser Stelle bringt Habermas Europa ins Spiel. In einem Folgeartikel zu Habermas’ Manifest verdeutlicht der Jenaer Historiker Norbert Frei Habermas’ allgemeine Argumente für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Vor dem Hintergrund des rechtspopulistischen Aufschwungs, der die Welt um uns herum in Unruhe versetzt, muss dies eine europäische Verteidigungsgemeinschaft sein, wie sie 1952–1954 auf dem Tisch lag, um die militärische Stärke Westdeutschlands nutzen und gleichzeitig binden zu können. Die Europäisierung der Verteidigung wäre eine Antwort auf die europäischen Bedenken gegenüber der deutschen Aufrüstung (Frei 2025).
Es geht also darum, Robert Schumans Kohle- und Stahlunion auf den militärischen Bereich zu übertragen. Für die europäischen Staats- und Regierungschefs und die öffentliche Meinung geht es darum, die Größe der Aufgabe zu verstehen und sich mit ihr zu identifizieren, die Robert Schuman 1950 hatte: Europa fünf Jahre nach dem Weltkrieg von der Notwendigkeit der Wiederbewaffnung Deutschlands zu überzeugen und den intellektuellen Mut aufzubringen, den diese Aufgabe erforderte. Und zu erkennen, dass diese Aufgabe heute ebenso unglaublich ist. Aber wie Schuman davon überzeugt zu sein, dass das Unglaubliche möglich ist, aber Handeln erfordert.
Die transatlantische Krise ist im Grunde eine Vertrauenskrise, ausgelöst durch die Unklarheit des US-Präsidenten über sein Engagement für die NATO und seine Pläne gegenüber Russland. Verlorenes Vertrauen angesichts externer Bedrohungen lässt sich nicht einfach wiederherstellen. Der Schaden ist auf absehbare Zeit nachhaltig. Die Situation erfordert unabhängiges europäisches Handeln durch verstärkte Zusammenarbeit. Das bedeutet nicht, dass Europa gegen die USA rebellieren oder die NATO verlassen muss, sondern dass es in seiner Planung und Vorbereitung über die USA hinausdenken muss. Dies ist weitgehend ein mentaler Prozess, der eine neue Sprache erfordert. Das Ziel des Bruchs muss so nah wie möglich an einer Scheidung à l’amiable und so ruhig und diskret wie möglich sein, um Putin zumindest in einer gewissen Unsicherheit darüber zu lassen, was geschieht. Aber er muss klar und bewusst sein.
Der Bruch muss auf der Überzeugung eines souveränen Europas beruhen, das in der Lage ist, selbstbewusst und aus eigener Kraft zu handeln. Das Gegenbild, das es zu zerstreuen gilt, ist das Foto, das um die Welt ging und auf dem die vier Musketiere Macron, Starmer, Merz und Tusk in Kiew zu sehen sind, wie sie Selenskyj ihre volle Unterstützung zusichern, während sie Trump auf einem auf dem Tisch liegenden Handy anrufen und ihn davon überzeugen, ihre Forderung nach einem Waffenstillstand voll und ganz zu unterstützen. Das Versprechen wurde am nächsten Tag gebrochen, und die vier waren diskreditiert. Die Musketiere waren Akteure der Hilflosigkeit, die Politikverdrossenheit befördern. Die vor uns liegende Aufgabe erfordert intellektuellen und moralischen Mut, der sich in konkreten Plänen für digitale Souveränität mit Alternativen zu GPS, den heutigen Cloud-Diensten, der Regulierung des Internets und vielem mehr niederschlagen muss. Gleichzeitig muss politische Unabhängigkeit so weit wie möglich mit einer tieferen Unterstützung der transatlantischen Zusammenarbeit innerhalb der Zivilgesellschaft, mit freiwilligen Organisationen und innerhalb der Forschungsgemeinschaft verbunden werden, um auf die Angriffe der Trump-Regierung auf Universitäten und Familien- und Freundschaftsbeziehungen zu reagieren. Europa muss als Zivilgesellschaft die demokratischen Kräfte in den USA unterstützen.
Freis Verweis auf die europäischen Verteidigungspläne der 1950er Jahre bedeutet nicht zwangsläufig eine Wiederholung der langwierigen und detaillierten Verhandlungen von damals und Überlegungen zur Aufgabe nationaler Souveränität. Dafür fehlt es an Zeit und am europäischen Willen. Es geht vielmehr um eine Koalition der Willigen zur Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit. Die Koalition der Willigen war schließlich der Ausdruck der Bush-Regierung für die europäischen Staaten, die sich dem Irakkrieg angeschlossen haben. Die Aufgabe besteht darin, ihre Bedeutung in einem diskursiven Kampf um eine neue Politik neu zu definieren. Deutschland, Frankreich, Polen, das Vereinigte Königreich sowie die nordischen und baltischen Länder könnten einen Kern dieser Vertiefung bilden, in dem mehr denkbar ist und die Vertiefung außerhalb des Kerns nicht so groß sein muss.
Die Probleme rund um die Zukunft Europas auf den militärischen Bereich zu beschränken, wäre ein großer Fehler. In der internationalen Unordnung, die sich infolge des Zusammenbruchs der Regeln entwickelt, der Teil der Politik von Trump und den Tech-Oligarchen unter dem Banner der Disruption ist, wächst der Bedarf an einem Europa, das in der Lage ist, Verantwortung für sich selbst und die Welt um sich herum auf neue Weise zu übernehmen. Die Krisensituation muss genutzt werden, um Regeln und Ordnung wiederherzustellen und eine koordinierte globale Politik gegen den Klimawandel zu ermöglichen, eine Alternative zu Kriegen, die Umwelt und Klima zerstören. Europa muss Verbindungen zu China finden, der weltweit führenden Macht im Bereich der Klimatechnologie und Befürworter einer internationalen, auf Regeln basierenden Ordnung. China ist jedenfalls nicht für eine systematische Zerstörung von Regeln. Die unterschiedlichen Auffassungen über Demokratie sind zwar erheblich, können aber kurzfristig kein Hindernis für eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Klima und internationale Regeln sein. Europa wird in ein Wettrüsten hineingezogen, das schwer zu vermeiden ist, aber es ist wichtig, Alternativen zu finden, die einen anderen Schwerpunkt in der Weltpolitik haben als die derzeitige Entwicklung, und dies ist möglicherweise auch im Interesse Chinas. Und in jedem Fall ist es im Interesse des Planeten. Es wäre fatal, sich in die Abwärtsspirale der USA hineinziehen zu lassen, vor der Habermas warnt.
In einer kraftvollen Rede in Brüssel am 8. Mai 2025 ging Etienne Balibar der Frage nach: ”Was nun für Europa?“. Balibar und Habermas sind das nicht synchronisierte französisch-deutsche Philosophenduo des Kontinents, der eine eher neo-/postmarxistisch und grün, der andere eher aufklärungsliberal, in ihrem unermüdlichen Plädoyer für ein anderes Europa. Das Datum der Rede war symbolisch, der 80. Jahrestag der Kapitulation in Reims und der Vorabend des 75. Jahrestags der Europarede von Robert Schuman. Balibar (2025) beklagte die Welle des Rechtspopulismus, die seit einem Jahrzehnt über Europa hinwegfegt. Viele in dieser Welle sehnen sich offen nach dem Faschismus und Nationalsozialismus, der den Kontinent in den 1920er und 1930er Jahren heimgesucht hat, als ob es nach zwei oder drei Generationen Zeit wäre, zu vergessen. Sie verfügen über bedeutende parlamentarische und diskursive Macht. In der europäischen Zusammenarbeit haben sie ein gefährliches Potenzial. Fremdenfeindlich und mit kleinlichen nationalistischen/imperialistischen Zukunftsplänen sind sie sowohl Rivalen als auch Gleichgesinnte. Angesichts der Epoche, aus der sie ihre Inspiration beziehen, sind Versuche, sie zu „zivilisieren“ oder zu „zähmen“, zwecklos. Die populistischen Parteien berufen sich alle auf nationale Größe und lehnen Vorstellungen von einer Souveränität auf europäischer Ebene ab. Stattdessen wollen sie ein europäisches Modell geopolitischer Allianzen und Konflikte zwischen Nationalstaaten, wobei Fremdenfeindlichkeit eine wichtige Triebkraft ist.
In Europa formt der Krieg in der Ukraine eine neue Teilung, ein Jalta 2. Europa muss sich mit einem expansionistischen Russland auseinandersetzen, das auf Putins Ideologie eines Großrusslands aufgebaut ist. Obwohl Putin im Gegensatz zu Napoleon und Hitler nicht die Kapazitäten hat, ganz Europa zu besetzen, umfassen seine Pläne so viel wie möglich vom alten Sowjetimperium, darunter nicht nur die Ukraine, sondern auch die baltischen Staaten. Darüber hinaus muss Europa damit rechnen, dass die USA die Ambitionen Russlands akzeptieren, im Gegenzug dass Russland die Ambitionen der USA in der Arktis akzeptiert. Obwohl ideologisch völlig unterschiedlich, ist eine russisch-amerikanische Zusammenarbeit zu erwarten. In kurzer Zeit hat sich die USA vom globalen Zentrum des Neoliberalismus zu einer nationalistischen/imperialistischen und neomerkantilistischen Macht gewandelt. Die Beziehungen zwischen dem russischen und dem amerikanischen Imperium stellen Europa vor eine völlig andere Herausforderung als der kapitalistische Wettbewerb zwischen den USA und China, die beide durch einen starken Staatismus gekennzeichnet sind. Dies wirft die Frage auf, was mit dem amerikanischen Staatismus geschehen wird, aber diese Frage ändert nichts an Balibars Gesamtbild.
Balibar räumt jedoch ein, dass seine Beschreibung der Situation einen großen Mangel aufweist. Sie berücksichtigt weder die Digitalisierung noch die Entwicklung der KI. Algorithmen verändern den öffentlichen Diskurs grundlegend. Algorithmen kolonisieren die sozialen Beziehungen. Die Beschreibung der Situation übersieht auch den Klimawandel und die Umweltkatastrophen sowie die damit verbundene Frage, wie das Wirtschaftswachstum im Norden und Süden organisiert werden soll, bemerkt Balibar.
Nachdem er Timothy Garton Ash, der als Antwort auf Trump und Putin ein europäisches Imperium befürwortet hat, kurz abgetan hat, wendet sich Balibar überraschend Alan Milward zu, der zur Zeit von Maastricht die viel diskutierte These aufgestellt hat, dass es bei der europäischen Integration nicht um einen Superstaat gehe, sondern um die Rettung des Nationalstaats, The European Rescue of the Nation-State (Milward 1992). In Milwards Buch findet Balibar ”die unwahrscheinliche Möglichkeit eines föderalen Europas”. In diesem Europa, das den Nationalstaat gerettet hat, ohne das der Nationalstaat nicht überlebt hätte. Entgegen der zeitgenössischen Debatte über die Unterscheidung zwischen Europa und den Nationalstaaten in dem Buch, in der die Rettung der Nationalstaaten im Vordergrund stand, betont Balibar Europa als Retter und gibt damit Impulse für eine neue Debatte zu diesem Thema. Balibar macht Europa zum handelnden Subjekt. In der Debatte um Milwards These waren die Nationalstaaten die handelnden Subjekte, während Europa nach ihrer Rettung in den Hintergrund trat. Was die Definition von Föderation angeht, sieht Balibar keinen grundlegenden Unterschied zwischen einem föderalen Staat und einer Konföderation. Die beiden Kategorien überschneiden sich, und die genaue Mischung ist eher eine Frage der historischen Perspektive als etwas teleologisch Vorprogrammiertes, eher eine Frage der Empirie als der Theorie.
Balibar betont, dass das Hauptproblem der EU in ihrer jetzigen Form darin besteht, dass sie eine Markt-EU ist, aber anders als in den Maastricht-Verhandlungen über den Binnenmarkt vorgesehen und sicherlich anders als Milward es sich vorgestellt hatte. Das Problem des Maastricht-Vertrags besteht darin, dass er keine soziale Integration als Gegengewicht zur wirtschaftlichen Integration vorsieht. Delors wollte dies, aber Thatcher setzte sich erfolgreich dagegen durch. Die Idee der Harmonisierung von Regeln und Standards wurde in die Sprache des Benchmarking, der Best Practices und der offenen Koordinierungsmethode übertragen, was letztlich dazu führte, dass sich die EU-Mitgliedstaaten auf den gegenseitigen Wettbewerb mit Druck auf die Sozialstandards konzentrierten, eine Entwicklung, die Mario Draghi in seinem Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der EU an die Kommission im Jahr 2024 kritisiert. Durch den internen Wettbewerb habe die EU es versäumt, sich für einen gemeinsamen externen Wettbewerb zu vereinen, schreibt er (Draghi 2024). Diese Vernachlässigung könnte im Zeitalter der Imperien teuer zu stehen kommen.
Mit seiner Beobachtung, dass es gerade soziale Fragen sind, die heute die Populisten und Nationalisten in Europa antreiben, leistet Balibar in seiner Neuinterpretation von Milward und mit seinem Verweis auf Draghi einen wichtigen Beitrag zur Debatte über die Zukunft Europas. Er fügt Habermas’ Forderung einen wichtigen Punkt hinzu: ein soziales Europa gegen die soziale Agenda der Nationalisten. Mit einem starken inneren Europa in sozialen Fragen, in dem der Grad der Supranationalität die Debatte nicht zerstört, kann sich Europa in einer alternativen Strategie zum Wettbewerb der Imperien, der auch im Süden stattfindet, neu gegenüber dem globalen Süden öffnen. Es ist zu hoffen, dass Balibars Ideen in einem Europa, das auf der Suche nach sich selbst tastend voranschreitet, Debatten und Maßnahmen anstoßen werden. Die Geschichte ist nicht alternativlos. Wenn nichts dagegen unternommen wird, ist auch eine Desintegration möglich.
Übersetzung von DeepL und Bo Stråth aus dem Schwedischen des Artikels Bo Stråth, ”En världsordning i upplösning. Vad nu? 1. Imperiernas möte i Europa och Europas svar.” Statsvetenskaplig Tidskrift Vol. 127 Nr. 2 Juni 2025
Referenzen:
Balibar, Etienne, 2025. ”L’impossible possibilité de la fédération européenne: hier, aujourd’hui, demain.” Öffentlicher Vortrag, Institut für Europastudien, Freie Universität Brüssel, ”Europatag”, 8. Mai 2025.
Chafkin, Max, 2022. The Contrarian. Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power. Bloomsbury.
Draghi, Mario, 2024. Der Draghi-Bericht: Teil A. Eine Strategie für die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Teil B. Analyse und Empfehlungen. Brüssel: Europäische Kommission, 9. September 2024.
Frei, Norbert, 2025. „Der Westen, wie wir ihn kannten, ist weg“, Süddeutsche Zeitung, 23. März 2025.
Fukuyama, Francis, 1992. The End of History and the Last Man. New York: Free Press.
Gilman, Nils, 2025. „A Planetary Geopolitical Realignment?” (Eine planetarische geopolitische Neuordnung?), Substack/Small Precautions, 19. März 2025.
Habermas, Jürgen, 2025. „Für Europa“. Süddeutsche Zeitung, 21. März 2025.
Heritage Foundation, 2024. „Project 2025 Mandate for Leadership. The Conservative Promise“. Verfügbar unter https://archive.org/details/2025_MandateForLeadership_FULL.
Huntington, Samuel, 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
Huntington, Samuel, 2004. Who Are You? Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. New York: Simon & Schuster.
Kagan, Robert, 2003. Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order. New York: Knopf.
Kagan, Robert, 2024. Rebellion. How Antiliberalism Is Tearing America Apart Again.. London: W H Allen.
Land, Nick, 2022. The Dark Enlightenment. Imperium Press.
Milward, Alan, 1992. The European Rescue of the Nation-State. London: Routledge.
Nietzsche, Friedrich, 1891. Also sprach Zarathustra. Band 4. Leipzig
Nussbaum, Emily, 2024. Cue the Sun! – Die Erfindung des Reality-TV. New York: Random House.
O’Toole, Fintan, 2025. ”Shredding the Postwar Order“, New York Review of Books, 24.04.2025.
Slobodian, Quinn, 2023. Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World without Democracy. London: Allen Lane.
Stiglitz, Joseph, 2025. ”Trump’s America: The New Global Tax Haven?“, Social Europe, 30.04.2025.
Stråth, Bo & Trüper, Henning, 2025. ”Conceptualizing Capitalism: Conversations with Henning Trüper. Blog 4. The Zeitgeist of Empire and Nihilism in Historical Perspective. And Capitalism?” Verfügbar unter https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/conceptualizing-.
Thiel, Peter, 2014. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future. New York: Random House.
Vance, J D, 2016. Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Blackstone.
Weber, Max 1980 [1922]. Wirtschaft und Gesellschaft. Hrsg. Johannes Winckelmann: Tübingen: Mohr.
Westad, Odd Arne, 2005. The Global Cold War. Cambridge: Cambridge University Press.
Weißes Haus, 14.02.2025. Vizepräsident JD Vance hält Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Verfügbar unter https://www.com/watch?v=pCOsgfINdKg
Erklärung des Weißen Hauses, 07.04.2025. Verfügbar unter https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/04/cea-chairman-steve-miran-hudson-institute-event-remarks/CEA Vorsitzender Steve Miran Hudson Institute Event Remarks – The White House.
Yarvin, Curtis, 2024. Gray Mirror. Fascicle I: Disturbance. Passage Press.
Fortsetzung folgt:
”Eine Weltordnung in Auflösung. Was nun? 2. Demokratie ohne Alternativen, Nihilismus und die Macht der Algorithmen.” September 2025
”Eine Weltordnung in Auflösung. Was nun? 3. Ein wertebasiertes Europa in einer nihilistischen Zeit. Auf dem Weg zu einem Nomos für eine globale Gesellschaft.” Dezember 2025
Wie man zitiert:
Cit. Bo Stråth, “Eine Weltordnung in Auflösung. Was Nun? 1. Das Aufeinandertreffen der Imperien in Europa und Europas Reaktion.” Blog. https://www.bostrath.com/planetary-perspectives/eine-weltordnung-in-auflosung-was-nun/ Published 06.07.2025
Comments
Please submit you comments with the Contact Form or send an Email to bo.strath@gmail.com.